Die Sanierung der Sozialversicherung:
Im sozialen Netz
Wer zahlt das Geld für die Renten – Das „Krankenversicherungskostendämpfungsgesetz“
Die Demokratie muß, „um dem Gemeinwohl aller und nicht nur einer bestimmten Schicht zu dienen, ein Sozialstaat sein.“ Das allgemeine Bewußtsein hält diese Forderung der Politologie ebensosehr für eine Binsenweisheit wie es sich darum streitet, was von einem anständigen Sozialstaat erwartet werden darf. Nicht einmal die Linken möchten an dem Dogma rütteln, daß es „sozial“ zugehen müsse im öffentlichen wie auch im privaten Lehen. Daß „sozial“ nichts weiter heißt als „die Gesellschaft betreffend“, ein „Sozialstaat“ also nichts mehr und nichts weniger ist als eine öffentliche Gewalt, die den Umgang mit all ihren Bürgern nach den Erfordernissen der Gesellschaft gestaltet, der sie ihre Gewalt verdankt, ist dagegen niemandem geläufig. Denn die öffentliche Moral und die ihr zugehörige Heuchelei stellen mit keinem anderen Schlagwort so gern auf die erfahrenen Unannehmlichkeiten der staatlichen Gewalt ein, wie mit der Kritik, der Staat sei zu wenig oder zu sehr sozial. „Zu wenig!“ behaupten diejenigen, die den Sozialstaat für den Garanten ihres eigenen Nutzens halten, dann, wenn sie das Gegenteil erfahren. „Zu sehr!“ diejenigen, die in den sozialen Pflichten des Staates eine oft lästige Begleiterscheinung seiner Selbsterhaltung sehen. So braucht es eigentlich nicht erst die Erinnerung daran, daß die Sozialpolitik kompensatorische Aufgaben des Staates gegenüber einer Klasse erledigt (Aufgaben, die er übrigens nicht freiwillig übernommen hat!), daß diese daher alles andere als Segnungen sind, daß diese Klasse allen Grund hätte, sich „unsozial“ aufzuführen.
Allein die beständigen öffentlichen Erinnerungen daran, daß die sozialen Rechte auch soziale Pflichten einschließen, daß der Sozialstaat nicht zum Wohlfahrts- und Versorgungsstaat pervertieren dürfe, daß die soziale Sicherheit an der selbstverantwortlichen Freiheit ihre Grenzen haben müsse, kann die Augen darüber öffnen, daß das Ideal des Gemeinwohls die Verhimmelung all der Gemeinheiten ist, die das Wohl einer bestimmten Schicht verlangt. Die Staatsbürgergesinnung aber hat an dieser Einsicht kein Interesse. Das mag für diejenigen noch angehen, die sich um ihre soziale Sicherheit nicht zu sorgen brauchen und sich daher ganz der Verteidigung ihrer Freiheit, Geschäfte zu machen, widmen können. Die Bürger aber, denen der Staat sich als Sozialstaat präsentiert, nutzen die Verwandlung ihrer Misere in den Vorwurf der „immer noch vorhandenen sozialen Benachteiligung“ nur zu einem – Opfer zu bleiben.
Und wenn die Revisionisten mit dem Ideal vom Sozialstaat, der erst noch zu verwirklichen sei, Politik treiben, dann mögen sie in der bürgerlichen Unzufriedenheit den Anknüpfungspunkt für ihre volksfreundliche Staatsmoral finden, zur Beseitigung der Gründe dieser Unzufriedenheit taugen sie nichts. Ihre theoretische Abteilung aber, die sich mit „marxistischen Sozialstaatsdebatten“ die Zeit vertreibt, eignet sich höchstens zur Legitimation einer Arbeiter- und Bauernstaat-Moral. Sie ist kritische Politologie, mißt das Reformtreiben der SPD am dazugehörigen Reformideal, wirft ihr deshalb Verrat und Scheitern vor, hat sich inzwischen als getreues Spiegelbild der bürgerlichen Politologie und ihrer Fehler im Wissenschaftsbetrieb sogar etabliert und vervollständigt ihn um die Sparte kritischer Marxismus – sprich Bezweiflung der Marxschen Einsichten unter dem methodischen Motto: „Wenn der Staat als Instrument der Klassenherrschaft begriffen wird, wie sind dann Maßnahmen zu interpretieren, die durch den oder mittels des Staates zugunsten der Arbeiterklasse durchgeführt werden?“ Solche Fanatiker sozialstaatlicher Gerechtigkeit halten natürlich die „Interpretation“ der MSZ am Beispiel der Renten- und Krankenversicherungsreformen, daß von „zugunsten“ keine Rede sein kann, höchstens für eine interessante Bereicherung der „unter dem Schlagwort des Sozialstaates geführten Debatte“, nicht aber für ihre Kritik und Beendigung.
Wer kann von der Arbeit leben
Der Rentenskandal, mit dem die Bundesregierung, frisch gewählt, die Legislaturperiode eröffnete (vgl. MSZ Nr.15/1977 „Blamiert bis auf die Knochen“), wäre keiner gewesen, wenn es dabei nur um seine Opfer, die Rentner gegangen wäre. Wie der Staat mit Bürgern umspringt, die nicht mehr arbeiten und nun kaum mehr genug zum Leben haben, weil sie einmal gearbeitet haben, ist dem öffentlichen Bewußtsein in der Regel kein Problem und erst recht kein Skandal. So geht nun auch die „Sanierung“ der Rentenversicherung ohne größere öffentliche Kontroverse über die Bühne, weil sich zum einen alle Parteien darüber einig sind, daß sie auf Kosten der Rentner bzw. der zukünftigen Rentner zu geschehen hat, und weil zum anderen ebenfalls alle Parteien wissen, daß die Rentner von allen Interessengruppen im Staate eine der ohnmächtigsten sind und man sich ihrer Einsicht in die staatlichen Notwendigkeiten und damit ihrer Stimmen in vier Jahren ohnehin sicher sein kann. Der Sozialstaat wird sich dann wieder als einer präsentieren, der seinen arbeitenden und arbeitsunfähigen Bürgern die Lasten, die er ihnen auferlegt, als Leistungen zu verkaufen versteht und dabei solange des Beifalls der Betroffenen sicher sein kann, als diese ihre soziale Sicherheit dem Staat anvertrauen und die damit erkaufte Unsicherheit als dafür zu zahlenden Preis zu tragen gewillt sind.

Das Geld ist weg oder das Märchen vom Generationenvertrag
Das Argument, mit dem die Regierung die Zahlungsunfähigkeit der Rentenversicherungsanstalt den Rentnern plausibel macht, ist die dreiste Lüge vom Generationenvertrag, an die sie als aufrechte Staatsbürger selber glauben. Sie dient mittlerweile auch der Legitimation der geplanten Maßnahmen zur Rentenversicherung:
„Dieser Vertrag beruht darauf, daß die arbeitende Generation solidarisch für die Rentner sorgt. Dabei weiß die Generation der Rentner, daß sie die Solidarität der Arbeitenden nicht überfordern kann.“ (Kanzler Schmidt in seiner Regierungserklärung vom 16.12.76)
Nun ist die arbeitende Generation keineswegs solidarisch bereit, die Alten zu versorgen – dies klappt nicht einmal bei den eigenen, wofür die Altersheime, die alles andere als ein Heim sind, Belege liefern – weshalb der Staat ihr auch zwangsweise einen Beitrag zur Altersversorgung abpreßt mit der Versicherung, durch diesen Abzug vom Lohn dem Arbeiter auch dann noch sein Auskommen zu sichern, wenn er einmal keinen Lohn mehr erarbeiten kann.
Die von Helmut Schmidt im Wahlkampf liebevoll kolportierte Geschichte von den Millionen fleißiger Hände, die dafür sorgen, daß die Alten was zum Beißen haben, verfeinert um die Geburtenstatistik, mit Hilfe derer die Rentenhöhe in Abhängigkeit von Pillenknick, Gebärfreudigkeit und Verlustziffern im Weltkrieg gesetzt wird, erweist sich als modernes Märchen angesichts der Tatsache, daß die jetzt untätigen Hände der Rentner, als sie noch tätig waren, die jetzt fehlenden Milliardenbeträge erarbeitet haben, die jetzt fehlen. Da die bundesdeutschen Rentner wie die Kinder an Märchen glauben, kommt die Frage erst gar nicht auf, wieso der Staat als Treuhänder der zweckgebundenen Rentenbeiträge diese für den entgegengesetzten Zweck ausgegeben hat als für den, wofür sie einbezahlt worden sind. Daß der Staat dies macht, ist so selbstverständlich, daß allenfalls gefragt wird, ob sie da, wo sie angelegt wurden, auch gut angelegt sind. Und auch hier gibt das Märchen positiven Bescheid: wenn die arbeitende Generation die Alten durchfüttern muß, dann muß sie auch arbeiten können und jede staatliche Mark für den Aufschwung der Wirtschaft ist so ein Stück Rentenversicherung:
„Die wirtschaftliche Sanierung einer Sozialversicherung, die ihre Verpflichtungen aus laufenden Beiträgen der aktiv im Beruf Stehenden erfüllen muß, hängt zwangsläufig von der Vollbeschäftigung ab, also von der Qualität der Wirtschaftspolitik und der Verantwortung der Sozialpartner.“ (SZ vom 18.3.1977)
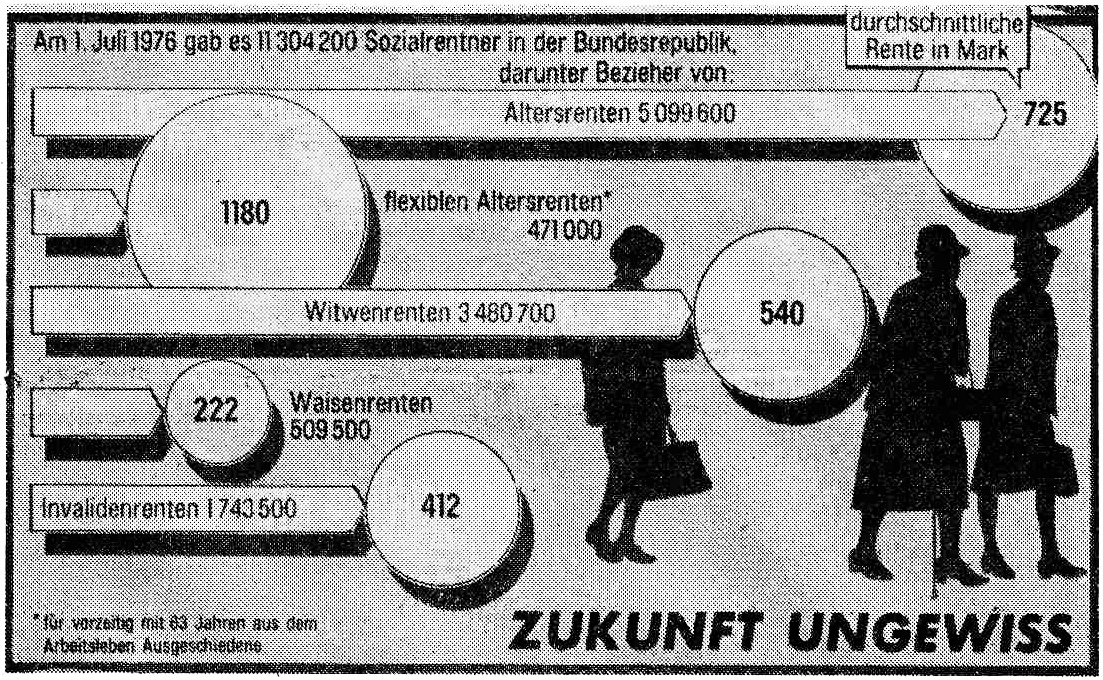
Für die Süddeutsche Zeitung ist aus dem Märchen also Wirklichkeit geworden, d.h. die Sauerei des Staates, der die Rentenversicherungsbeiträge dem Kapital überweist, beurteilt sie nach der „Qualität der Wirtschaftspolitik“ und spricht im gleichen Zusammenhang auch offen aus, von welchem Standpunkt diese zu beurteilen ist:
„Wenn nämlich die Bundesregierung bis 1980 von einer Lohnsteigerung um jährlich 7,5% ausgeht, so ist nach gegenwärtiger Lage der Dinge wohl kaum damit zu rechnen, daß die Arbeitslosenziffer im erwünschten Ausmaß sinken wird, im Gegenteil: Der Rationalisierungsdruck dürfte wachsen, neue Kräfte freisetzen. Das Ziel, die Vollbeschäftigung über den einzig richtigen Weg der kräftigen Neuinvestition zu erreichen, wird verfehlt.“
Auf die arbeitende Generation kommt also nach Einschätzung der Bundesregierung noch einiges zu, was der SZ noch nicht reicht: sie soll arbeiten, auf Lohnerhöhungen verzichten und zugleich die Rentenversicherung durch ihre Beiträge garantieren. Eben diese sollen aber der Wirtschaft auch noch die Mittel für „kräftige Neuinvestitionen“ bereitstellen und das Ganze muß der „arbeitenden Generation“ noch mit dem Argument schmackhaft gemacht werden, damit ihr eigenes Auskommen langfristig „bis ins hohe Alter“ zu sichern. Wie man sieht, kulminiert das Märchen vom Generationenvertrag wie alle Märchen in einem Wunder, nur mit dem Unterschied, daß der Staat das Märchen wahr macht, wie die Pläne zur Sanierung der Sozialversicherung zeigen.
Das Geld muß her oder Das ganze Risiko in einen Topf
Der erste Koalitionsbeschluß zur Rentensanierung, die Entlastung der Rentenversicherungsanstalten durch Belastung der Arbeitslosenversicherung, welche für die Finanzierung der Rentenbeiträge Arbeitsloser nun aufzukommen hat, ist von so notorisch kurzsichtigen Kritikern der SPD /FDP-Regierung wie dem CDU-Exkanzlerkandidaten Helmut Kohl als simpler Trick verkannt worden:
„Hier wird ein Loch nur dadurch gestopft, daß man anderswo eins auf reißt.“ (Kohl im ZDF)
Tatsächlich holt sich der Staat das Geld da, wo es zu holen ist, bei seinen lohnabhängigen Bürgern: die Mehrbelastung der Arbeitslosenversicherung wird dadurch mehr als hereingeholt, daß die am 1.1.1976 beschlossene Erhöhung des Beitragssatzes von 2% auf 3% nicht wieder – wie versprochen – rückgängig gemacht wird. Das Risiko der Rentner, ihre Renten nicht mehr in voller Höhe, geschweige denn angepaßt an die Einkommensentwicklung zu bekommen, wird den Arbeitern und Angestellten aufgehalst, die sich die Absicherung gegen das ihnen ständig eigene Risiko, arbeitslos zu werden, zukünftig mehr kosten lassen müssen, noch dazu mit dem sinnigen Argument, dies käme ihnen ja auch zugute, für den Fall nämlich, wo sie am Ende ihrer Tage arbeitslos, weil nicht mehr arbeitsfähig sein werden:
„Es ist nur konsequent, das Finanzrisiko von der Solidargemeinschaft »Rentenversicherung« auf die Solidargemeinschaft »Arbeitslosenversicherung« zu übertragen. Wenn auch die Zahlenden die gleichen – nämlich die jeweils Erwerbstätigen – sind, so ist diese Lösung doch in dem Sinne die sauberere, daß jedem Risiko ein bestimmter Topf zugeordnet wird.“ (SZ vom 15./16.1. 1977) Sauber!!
Die Lohnabhängigen zahlen also in zwei verschiedene Töpfe für ein Risiko, aber alles aus dem gleichen Topf, ihrer Lohntüte. Und damit die Alten merken, daß wer nicht mehr arbeitet das volle Risiko eingeht, schlägt die Bundesregierung bei der Berechnung der Neurenten noch einmal zu: war das „lohnintensive Jahr 1974“ für den Staat zumindest in einer Hinsicht erfreulich, nämlich derjenigen, daß mehr Lohnsteuern und Sozialabgaben in seine Kassen flössen, so erscheint es ihm als allgemeine Berechnungsgrundlage bei Neurenten so unerfreulich, daß er es aus seinem Kalender streicht und dadurch die Neurenten empfindlich senken kann. Zudem wird der Neurentner für die starke Steuerbelastung, der er als Lohnabhängiger in den letzten Jahren ausgesetzt war, mit der für 1979 vorgesehenen Anpassung der Renten an die Nettolöhne geschädigt: Zusammen mit dem Ausfall der Erhöhung von 1978 addieren sich diese Maßnahmen für die Rentner ab 1979 zum Verlust einer ganzen Monatsrente. Und auch denjenigen, denen der Staat zu Zeiten ihrer „Erwerbstätigkeit“ nicht lange genug Beiträge abzwacken konnte, droht die Schröpfung jetzt im erwerbslosen Alter: wer weniger als 20 Jahre Beiträge zur Krankenversicherung geleistet hat, muß nach dem Gesetzentwurf der Regierung als Rentner einen zusätzlichen Beitrag leisten.
Flankierende Maßnahmen oder Risse im sozialen Netz
Da der Staat noch nicht in der Lage ist, sich von Toten was zu holen, verlegt er sich fürs erste auf die Kranken. Mit Hilfe des „Krankenversicherungskostendämpfungsgesetzes“ verfolgt die Bundesregierung den doppelten Zweck, einerseits die Krankenkassen zu entlasten –
„Die Selbstbeteiligung der Kassenpatienten an den Arzneimitteln, die bislang 20% bis höchstens DM 2.50 betrug, wird auf 20% bis zu DM 3.50 erhöht. Die Rentner werden in diese Selbstbeteiligung einbezogen.“ (FAZ vom 17.2.1977) –
andererseits dem Arbeitsmann im Krankheitsfall rascher dadurch wieder auf die Füße zu helfen, daß ihm zeitraubendes und teures Auskurieren der Krankheit unmöglich gemacht wird: die Inanspruchnahme von Kuren wird erschwert und die finanzielle Unterstützung für eine häusliche Krankenhilfe gestrichen. Das ganze läuft unter dem unverschämten Titel „Selbstbeteiligung“, womit erstens so getan wird, als finanziere der Staat die Behandlung der Kassenpatienten und nicht diese selbst mit ihren Beiträgen und zweitens die Tatsache, daß der kapitalistische Arbeitsprozeß die ihm Unterworfenen ständig krank macht, in den Verdacht umgelogen, bei kranken Arbeitern handle es sich oftmals um Simulanten, für die der Griff in den eigenen Geldbeutel die beste Medizin darstelle. Ferner wird die „flexible Altersgrenze“ als „sozialer Fortschritt“ in den Regierungsmaßnahmen ausdrücklich beibehalten, ja der Gebrauch dieser Möglichkeit weiterhin propagiert, sieht Sozialminister Ehrenberg doch nicht zuletzt darin einen Weg, die „Aufgabe Nummer eins“ seiner Regierung lösen zu helfen:
„Konzentration aller gesellschaftlichen Kräfte auf die schrittweise Verbesserung der Beschäftigungslage. Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung ist Aufgabe Nummer eins.“ (SZ vom 21.1.1977)
Der vom Schuften vor der Zeit verschlissene Arbeitsmann handelt sozial verantwortlich, wenn er mit reduzierter Rente (da weniger Beitragsjahre) Lebensabend macht, und macht einen Platz frei für jüngere Kollegen, deren bessere Arbeitskraft natürlich wesentlich mehr zur Sanierung unserer Wirtschaft beiträgt, in deren Kontext ja vor allem die Rentensanierung „langfristig“ zu sehen ist.
So ist auch klar, daß das Defizit der Rentenversicherung keinesfalls durch den Abbau ihrer Rücklagen, die sich auf 26 Milliarden DM belaufen, ausgeglichen werden darf. Diese Rücklagen sind illiquide und zwar deswegen, weil sie an konjunkturpolitisch bedeutsamer Stelle festgelegt wurden und man sie den Kapitalisten nicht ohne weiteres wegnehmen will. Und weil die Arbeiter für die Wirtschaft sind, genügt der Hinweis auf die Folgen, die eine Reduzierung der Rentenrücklagen für die Konjunkturpolitik hätte:
„Die Schwierigkeit liegt darin, daß gerade im nächsten Jahr eine Belastung des Geld- und Kapitalmarkts durch Liquiditätsansprüche der Rentenversicherung konjunkturpolitisch nicht erwünscht ist.“ (SZ vom 31.7.1976)
Eine Verwendung der Rentengelder zur Rentenzahlung erscheint vom Standpunkt der Wirtschaft nachgerade als Zweckentfremdung, liegt doch der geeignete Zweck des den Arbeitern abgezwungenen Beitrags immer noch darin, den Kreditspielraum des Kapitals zu erweitern. Dessen wissenschaftliche Lakaien befanden denn auch „einhellig“:
„Entgegen Ehrenbergs treuherziger Versicherung, hohe Rücklagen seien in der auf dem Umlageprinzip beruhenden Rentenversicherung »systemfremd« befand der Beirat »einhellig«, daß die nach den jetzigen Rechnungen im Jahre 1980 verbleibende effektive Rücklage nicht ausreicht.“ (Spiegel, Nr. 12/1977)
So zeigt sich zu guter Letzt an einer Maßnahme die Ehrenberg nicht vorschlägt, wem das soziale Netz nützt und wer als Opfer in ihm zappelt: auf eine gesetzlich vorgeschriebene Beschränkung des Rücklagevermögens zugunsten seiner Liquidierung für die Sicherung der Rentenzahlung will Ehrenberg sich „keinesfalls festlegen“.
Die Substanz der sozialen Sicherung oder: Wer kann von Arbeit leben
„Für die Regierungskoalition ist es dabei eine selbstverständliche Rahmenbedingung ihres Programms, daß die Substanz der sozialen Sicherung auch unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen nicht angetastet werden darf. Das heißt die dynamische Rente bleibt bestehen; die Rentner nehmen auch weiterhin am wirtschaftlichen Wachstum teil.“ (SZ vom 21.1.1977)
Durch die Dynamisierung der Rente (jährliche Angleichung an das Arbeitnehmereinkommen), und d.h. die Teilhabe am wirtschaftlichen Reichtum, bringen auch sie ihre Opfer für den Konjunkturzyklus des Kapitals. Anders als zu Zeiten ihres Arbeitslebens, wo sie durch vermehrte Schufterei und Reallohnverzicht das Wachstum des Kapitals in Krisenzeiten wieder beschleunigten, bleibt ihnen als Rentner in der Regel nur die Möglichkeit des Verzichts, gegen die sie – dies der Unterschied zur arbeitenden Generation – nichts unternehmen können, weil sie dem Verlust ihres einzigen Druckmittels gegen Kapital und Staat, ihrer Arbeitsfähigkeit, ihr Rentnerdasein verdanken. Einzige Möglichkeit zur Aufbesserung der Rente ist denn auch in Zeiten des Heißhungers nach Arbeitskraft die erneute Verdingung der alten Knochen als „rüstiger Rentner“, wobei sie aber Vorsicht walten lassen müssen, daß sie bei zu hohem Entgelt nicht ihrer Rente verlustig gehen bzw. vom Staat über Steuern und Abgaben so geschröpft werden, daß sie besser als Rentner von der verbliebenen Rüstigkeit keinen Gebrauch machen.
Das Los des Rentners veranschaulicht, wozu man es durch eigene Arbeit bringen kann: zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Als Lohnarbeiter reicht der Lohn zum Leben nur, solange man arbeiten kann. Deshalb muß der Staat die Lohnabhängigen zwingen, vom Lebensnotwendigen etwas abzuzweigen als Versicherung für den Fall des Verlustes der Arbeitskraft bei Krankheit und Alter bzw. für den Fall, daß die Arbeitskraft zwar intakt ist, aber vom Kapital gerade nicht gebraucht. Am Rentner exerziert der Staat brutal vor, daß ihm seine Bürger nur solange wichtig sind, als sie arbeiten können, indem er ihnen einen Teil ihres Geldes, das sie als Rentenversicherung abgeführt haben (den anderen führen sie ans Kapital ab), als Gnadenbrot des Staats zurückerstattet. Die ganze Kritik an der Rentenpolitik der Bundesregierung schert sich deshalb auch einen Dreck um die Rentner, sondern sorgt sich um die Glaubwürdigkeit des Staates: wenn dessen lohnabhängige Bürger trotz Zwangsversicherung fürs Alter um ihre Rente bangen müssen, so hat dies Auswirkungen auf den „sozialen Frieden“ und die Parteien» die gewählt werden wollen, müssen auch die Millionen Rentnerstimmen im Auge behalten. Ihnen allen muß Kanzler Schmidt beteuern, daß
„unsere in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase getroffenen Entscheidungen geeignet sind, die Rentenversicherung zu konsolidieren und damit die Altersversicherung der Bürger zu sichern.“

Einer kleinen Minderheit seiner Bürger hat er damit auch die Sicherung des Lebens in der Blüte ihrer Jahre verschafft, die deshalb auch mit dem Alter kein finanzielles Problem haben und für die der Begriff Rente nicht den Beigeschmack von Altersheim und armseligem Leben hat. Das dtv-Lexikon definiert denn auch „Rentner“ klassenneutral so:
„Rentner, überwiegend nicht berufstätige Person, die von einer Rente lebt; diese kann aus Kapital- oder Grundbesitz (Kapital-R.), einer Privat- oder Sozialversicherung (Versicherungs-R.) fließen ...“
Womit in gewohnter lexikalischer Objektivität verschleiert ist, wer von Arbeit leben kann: wer nicht von der eigenen Arbeit leben muß, sondern andere für sich arbeiten lässt.
Die Betroffenen nehmen Stellung: 1. Die Interessenvertretung der Arbeitnehmer
Vom Standpunkt des DGB ist an der Sanierung der Rentenversicherung zu Lasten seiner aktiven und nicht mehr aktiven Mitglieder nur eins auszusetzen. Er wurde nicht gefragt:
„Ja glaubt denn die Bundesregierung wirklich, daß sie mit einer so gearteten Politik die Arbeitnehmer noch für sich einnehmen kann? Zumal dann, wenn sich heute schon abzeichnet, daß der Opfergang der Arbeitnehmer für die Versäumnisse aller Parteien erst beginnt und die Bundesregierung wie kaum zuvor darauf angewiesen ist, mit allen Gutwilligen zusammenzuarbeiten.“ (Metall, Nr. 1/77)
Daß es der neue Arbeitsminister Ehrenberg nicht für nötig hielt, sich nach seinem Amtsantritt mit dem DGB zu unterhalten, stellt dessen „Gutwilligkeit“ auf eine harte Probe, weil seine erprobte Bereitschaft, seine Mitglieder auf den „Opfergang“ für den Staat zu schicken, nicht in Anspruch genommen wurde. Ungerührt bietet er dem Staat weiterhin seine Dienste bei der Schaffung von Bereitwilligkeit zum freudigen Verzicht an:
„Wir haben uns in der Vergangenheit denen nicht versagt, die eine Problemlösung unter rechtzeitiger Beteiligung aller Betroffenen angestrebt haben ... Das gilt auch dann, wenn die Eingriffe schmerzlich und unpopulär sind.“ (ibid.)
Die Gewerkschaft bietet der Regierung ihre guten Dienste bei der Agitation der Betroffenen an und kommt erst gar nicht auf den Gedanken, sich für ihre Mitglieder dadurch einzusetzen, daß sie von der Regierung Maßnahmen fordert, die andere betroffen machen könnten: etwa die Übernahme der erhöhten Soziallasten durch die Kapitalisten. Stattdessen fordert er die gleichmäßige Verteilung des Schadens auf Arbeitnehmer und Rentner –
„Es sollten nach Meinung des DGB – wenn Belastungen nicht zu umgehen sind – diese gleichgewichtig sowohl auf die Arbeitnehmer als auch auf die Rentner verteilt werden.“ (Gewerkschaftliche Monatshefte, Nr.3/1977) –
und krönt seine Bemühungen um die Entlastung des Staatshaushalts von lästigen Verpflichtungen gegenüber den Rentnern durch den Appel an
„Nachbarschaftshilfe, familiäre Hilfe – auch das wären Mittel, die Lebenslage dieser Bevölkerungsgruppe zu verbessern.“ (ibid.)
Die Bundesregierung wird sich diesen Tip zu Herzen nehmen bei der Begründung ihres nächsten Schlags gegen „diese Bevölkerungsgruppe“ und auch das Kapital könnte mal gewerkschaftliche Lohnforderungen mit dem Appell an die „Nachbarschaftshilfe“ kontern.
2. Die Partei der Arbeiterklasse
In der „Zeitung der arbeitenden Menschen“ der UZ, mobilisiert die DKP die Volksgemeinschaft unter der Schlagzeile „Betrug an unseren Rentnern“ (UZ vom 10. 12. 1976). Da auch ihr als Skandal nur auffällt, daß die Regierungskoalition ihr Wahlversprechen gebrochen hat, fällt ihr als Forderung das gleiche ein wie der CDU: „Wir fordern: Wahlversprechen einlösen! Höhere Renten fristgerecht am 1. Juli nächsten Jahres!“ Allerdings weiß sie sich von den Christdemokraten sehr wohl abzugrenzen („Gleichzeitig wies der DKP-Politiker die scheinheilige Entrüstung auf Seiten der CDU und der CSU zurück.“). Die DKP weiß nämlich, wo das „Geld zur Sicherung der Renten“ zu holen ist:
„In den Etatposten für die Subventionen und Steuergeschenke an die Konzerne und in den Posten für die wachsenden Rüstungsprogramme.“
Wo der Staat augenscheinlich demonstriert, dass er die Rentenversicherung deshalb sanieren muß, weil er das Geld zur Sanierung seines Haushalts verwandt hat, eben für die Konzerne und eben auch für die Rüstung, also Gelegenheit wäre, mit Illusionen aufzuräumen, die im Staat des Kapitals den Sozialstaat sehen, der leider pflichtvergessen immer die gleichen unter seinen Bürgern zugunsten der Minderheit, auf die es ihm ankommt, benachteiligt, schürt die DKP bei den betroffenen „arbeitenden Menschen“ kräftig das Vertrauen in den Staat durch den Vorwurf, seine Repräsentanten seien leider Gangster („Betrug“). Wie das Amen in der Kirche folgt auf der gleichen Seite auch das leuchtende Beispiel, wie es auch anders gehen könnte:
„Am 1. Dezember trat in der DDR eine umfangreiche Rentenerhöhung in Kraft. Für rund 3,4 Millionen Veteranen der Arbeit wurden die Renten um durchschnittlich 40 Mark erhöht.“
Womit über den Arbeiter- und Bauernstaat in erfrischender Offenheit klargestellt ist, daß man in der DDR vom Verkauf seiner (sozialistischen) Arbeitskraft leben muß, dies aber nicht kann, weswegen es auch drüben Rentner gibt, die allerdings Veteranen der Arbeit heißen, was über einen Arbeitsprozeß, der die ihm Unterworfenen als Veteranen entläßt, schließlich zumindest soviel aussagt, daß die ihm Unterworfenen anscheinend soldatische Tugenden aufweisen müssen.
Der Sozialstaat in der Bewährung oder Wer den Schaden hat, braucht für die Prügel nicht zu sorgen
Weil DGB und DKP versäumen, die in ihnen organisierten Lohnabhängigen in ihrem Vertrauen in den Staat, der für sie sorgt, zu kritisieren, können die kritischen Parteigänger des Staates umso unverfrorener – ihnen die Ansprüche, die sie mit ihrer Staatsloyalität immer noch verbinden, austreiben:
|
Hier wird erstens der Zweck des „sozialen Netzes“ knallhart ausgesprochen, dann werden seine Opfer dafür beschimpft, daß sie sich diesen noch nicht ausreichend zu eigen gemacht haben, das Ganze mit dem Ziel, dem Staat hungrig zu vertrauen. Was der Sozialstaat ist und was er nicht ist – schöner kann man es kaum sagen. |
Wer sich kranksein nicht leisten kann
Ganz Staatsmann versieht Minister Ehrenberg das Schröpfen der Bürger mit der flankierenden Maßnahme des Sparens: er will die „Kostenexplosion“ im Gesundheitswesen „eindämmen“, wobei die Lüge, mit der er sein Programm propagiert, Gesundheit würde immer teurer, in einer Öffentlichkeit lange Beine hat, die ohnehin daran gewöhnt ist, daß alle Waren teurer werden, also sich mitnichten daran stößt, daß auch die Krankheit einen Preis hat, den jeder bezahlen muß, sofern er gesundbleiben möchte. So malt das Deutsche Nachrichtenmagazin folgendes Schreckbild des Gesundheitswesens:
„Seit 1960 kletterten die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenkassen und der Ersatzkassen für Ärzte, Arzneimittel und Spitäler von neun auf rund 68 Milliarden Mark, weit schneller als alle anderen Bereiche der Volkswirtschaft. Die Ausgaben liefen den Einnahmen, die vom Anstieg der Lohnsumme abhängig sind, derart davon, daß seit 1960 die Beitragssätze in der Krankenversicherung von damals zwischen sechs und acht Prozent der Bruttoeinkommen auf jetzt fast das Doppelte angehoben werden mußten. Gelingt es nicht, die Steilkurve der Kosten einzudrücken, so ist die Zeit vorausberechenbar, in der das soziale Netz durch Selbstzerstörung endet. Im Jahr 2000, so rechnete der Bundesverband der Ortskrankenkassen vor, würden bei ungebrochenem Trend fast 60 Prozent der Einkommen für die Gesundheit draufgehen.“ (Spiegel, 8/77)
Die „Kostenexplosion“ im Gesundheitswesen
Für den Politiker ist an dieser Perspektive nicht das Schlimme, daß im Jahr 2000 die Gesundheit zu teuer für die meisten Bürger sein wird, sie also mit der Krankheit werden leben müssen, um überhaupt leben zu können – ihm wird hier dreierlei zum Problem, was zwar mit der Gesundheit des Volkes nichts, alles jedoch mit dem Gesundheitswesen des Staates zu tun hat: 1. Die Ausgaben für die Kranken bringen die Volkswirtschaft nicht voran. 2. Die Kompensationsfunktion des „Sozialen Netzes“ ist im Eimer, wenn „60 % der Einkommen“ (gemeint sind wohl die Einkommen aus eigener Arbeit) für die Gesundheit draufgehen. Dann könnten „soziale Unruhen“ ins Haus stehen. 3. Und was den Staat jetzt schon ganz unmittelbar aufs äußerste beunruhigt: seine Ausgaben, vor allem für die Krankenhäuser, steigen ständig. Die Form, die der Staat dem Gesundheitswesen gegeben hat, die Selbstverwaltung, ist ihm nicht mehr „volkswirtschaftlich vernünftig“ genug, weshalb er neue „Rahmenbedingungen der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens“ zu erstellen gedenkt. |
 |
Angesichts der steigenden Kosten entdeckt der Staat, daß sein Gesundheitswesen die Krankenfürsorge nicht mehr gewährleiste, tut dabei unverschämterweise so, als habe er je die Gesundheit seiner Bürger gewährleistet und bringt in seinen Reformvorschlägen gleich zur Anschauung, daß er nicht daran denkt, das deutsche Gesundheitswesen zu verändern, etwa dadurch, daß der Staat es in eigene Regie nähme. Nun würde zwar dadurch aus dem Krankheitswesen in der BRD noch lange kein Gesundheitswesen, die Sozialdemokraten und ihr ehrenwerter Minister Ehrenberg setzten sich aber dem Verdacht aus, ein Stück Sozialismus durch die Krankenhaustür einschleichen zu lassen. Dagegen setzt sich die SPD/FDP-Regierung entschieden zur Wehr: warum sollte sie auch den Unmut der Betroffenen, der sich bislang gegen die Selbstverwaltung der medizinischen Versorgung richtet, dadurch auf sich ziehen, daß sie zu sehr in diese ein greift:
„Es gibt in diesem Gesetzentwurf keinerlei ideologische Fäden. Es gibt einen Generalnenner, nämlich den, zu mehr Kostenbewußtsein bei allen Beteiligten zu kommen, ohne die ärztliche Versorgung zu mindern.“ (Spiegel, 8/77)
Am „gewachsenen System“ (Ehrenberg) wird also nicht gerüttelt. Die an ihm Beteiligten sollen lediglich mit einem anderen Bewußtsein ausgestattet werden. Aus der Medizin bekannt, daß richtiges Bewußtsein der Patienten manchmal Wunder tut, wo jede ärztliche Kunst versagt, warum nicht auch bei ihrer Finanzierung? Zu allererst die Kranken haben sich also gefälligst eine andere Einstellung zu ihrem Pech zuzulegen, vielleicht – dies der wünschenswerteste Fall – kommen sie dann darauf, daß sie eigentlich gar nicht krank sind, nur wehleidig, oder, wie die Bildzeitung in gewohnter faschistoider Avantgarde so ziemlich jedem maroden Arbeiter unterstellt, arbeitsscheu, wogegen das gesunde Volksempfinden ein probates Heilmittel weiß: statt zum Doktor gehen, Sultan diese Typen arbeiten« das wird sie schon kurieren.
Der Staat selbst, vorausdenkender weil über den streitenden Parteien stehend, bemüht sich um den guten Zustand des Arbeitsviehs seit längerem durch Prophylaxe wie die Trimm-Dich-Kampagne und Aufrufe zur kalorienbewußten Ernährung: in bunten Broschüren macht die Bundesministerin für Gesundheit dem Arbeitsmann klar, daß die Freizeit nicht zum Schlemmen und Faulenzen da ist, sondern der Ertüchtigung eines kalorienmäßig kurzzuhaltenden Körpers dient, der fit gehalten werden muß für den Dienst an Kapital und Staat. Solche Agitation fruchtet jedoch wenig, was ihre zunehmende Penetranz zeigt, weil der Arbeitsprozeß seine Opfer zu kräftezehrender Freizeittrimmerei untauglich macht und Fressen und Saufen zu den Kompensationen zählt, die auch für das begrenzte Geld des Lohnabhängigen zu haben sind.
Neben die Propaganda tritt daher der Zwang: wer so wenig verdient, daß die vorübergehende Unbrauchbarkeit seiner Arbeitskraft existenzgefährende Auswirkungen hat, zugleich aber für seine intakte Arbeitskraft so wenig Geld kriegt, daß er freiwillig davon nichts für den Notfall auf die hohe Kante legen kann, der wird dazu per Gesetz gezwungen:
„So ist die Sozialversicherung heute die gesetzliche Sicherung der Arbeiter, Angestellten, Handwerker und Landwirte gegen die wirtschaftlichen Folgen bestimmter Wechselfälle, welche die Verwertung ihrer Arbeitskraft bedrohen (Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit), und zur wirtschaftlichen Vorsorge für das Alter.“ (Beck–Rechtsinformation: Die soziale Krankenversicherung, München 1975, S. 12)
Die hier vollzogene Gleichstellung von Krankheit und Arbeitslosigkeit unter dem Titel Wechselfälle und das schöne Eingeständnis, daß, wer auf die Verwertung seiner Arbeitskraft zum Leben angewiesen ist, davon nicht leben kann, fuhren zur Ableitung der Zwangsversicherung aus der sozialen Demokratie:
„Sozialversicherung ist für unser heutiges Dasein etwas Selbstverständliches. Wir könnten uns unser Staatswesen und das Leben darin ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Sie verwirklicht das im Art. 20 unseres Grundgesetzes enthaltene Gebot, daß unsere Bundesrepublik, ein demokratischer und sozialer Bundesstaat' zu sein habe.“ (ebda)
Was die Gesundheit kosten darf ...
Der Zwang zur Sozialversicherung wird zur Selbstverständlichkeit durch das Gedankenexperiment, man solle sich den Staat und den kapitalistischen Arbeitsprozeß mit seinen gesundheitszerstörenden Auswirkungen mal ohne sein Gesundheitswesen vorstellen. So wird auch die mieseste Versorgung der Kassenpatienten noch zur Wohltat des Staates, für die der Pflichtversicherte dankbar zu sein hat, statt daran rumzumäkeln.
Die so als Staatsleistung kodifizierte Gesundheit verlangt von ihren Funktionären, daß mit ihr sparsam umgegangen wird: auf der Basis der festgesetzten Leistungen und Honorare lassen die Ärzte dem Patienten genau die Behandlung zuteilwerden, die ihm zusteht. Da die Gesundheit des Kassenpatienten einerseits Kostenfaktor für die Kassen, andererseits seine Krankheit Quelle des Einkommens für den Arzt ist, achten die Ärzte beim Gewinnemachen darauf, nicht mit den Kassen in Konflikt zu geraten, die bestimmte Leistungen, die nach Maßgabe medizinischer Erkenntnis optimal wären, nur nach Maßgabe zumutbarer Kosten liquidieren. Und damit sie die Krankheit ihrer arbeitenden Patienten nicht über die Gebühr ausheilen, haben die Kassen den Ärzten noch Vertrauensärzte beiseite gestellt. Geht beim normalen Kassenpatienten die Angleichung der Behandlung an das finanziell Erlaubte auf Kosten der Gesundheit, so können Bürger, die mehr als DM 2850,- monatlich verdienen, durch die Mitgliedschaft in einer Privatkasse, die bis zu sechsfache Honorare an die Ärzte bezahlen, das Optimum ärztlicher Kunst und Dienstleistung einkaufen und sich dabei des Wohlwollens der geforderten Medizinmänner sicher sein, weil für diese die Gesundmachung von Privatpatienten mit ihrer eigenen pekuniären Gesundung verbunden ist. Gilt für Bürger jenseits der DM 2850,- Grenze die Weisheit des Volksmunds „Lieber reich und gesund ...“, so lassen sich die Ärzte bei der Abfertigung der Bürger diesseits der DM 2850,- von dem Spruch leiten „Kleinvieh macht auch Mist“, was den Pflichtkassenpatienten zwar müßige Wartezeiten in den Praxen beschert, dafür aber umso brutalere Abfertigung im Behandlungszimmer garantiert.
An diesem System rüttelt Ehrenberg natürlich nicht, weil ihn nicht die Gesundheit der Bürger juckt, sondern was sie den Staat kostet. Und weil es um die Kosten geht, beginnt die „Reform des Gesundheitswesens“ bei den öffentlichen Krankenkassen, Zur Entlastung der Kassen ist vorgesehen, die Rezeptgebühr von DM 2.50 auf DM 3.50 zu erhöhen und damit faktisch
„die Medikamente für leichtere Fälle und Medikamente, die den Charakter von Hausmitteln haben oder die dem täglichen Lebensbedarf zuzurechnen sind, wie zum Beispiel Pflaster, Vitamine, leichtere Beruhigungsmittel, nicht mehr zu erstatten.“ (FAZ vom 12.2.77)
Wenn leichtere Beruhigungsmittel zum täglichen Bedarf gehören, dann läßt das einerseits Schlüsse auf die Gesundheitslage der Nation zu, andererseits ist klar, wer diesen ersten Reformansatz finanziert: der Patient, der bei (gleichbleibendem bis) steigendem Kassenbeitrag nun gleich doppelt zur Kasse gezwungen wird. Der zweite Schlag Ehrenbergs zielt auf das Verhältnis Kassen – Ärzteschaft. Bei den Verhandlungen zwischen diesen Parteien zogen die Kassen regelmäßig den kürzeren aufgrund ihrer Ausgangsposition, angesichts eines Gesundheitswesens, in dem die Ärzte die vom Staat beauftragten Verwalter der Krankheit sind und ihr Interesse als den Standpunkt der Volksgesundheit vortragen können. Die Kassen hingegen dürfen keinen Profit machen, haben deshalb auch nichts gegen die hohen Kosten ärztlicher Tätigkeit. Gegenüber einer einheitlich auftretenden Ärztelobby, die die finanzielle Gesundheit ihres Standes als conditio sine qua non eines funktionierenden Gesundheitswesens Jahr für Jahr den untereinander konkurrierenden Kassen (neben der AOK gibt es Innungs- und Ersatzkassen) in Form immer höherer Leistungssätze abtrotzten, legt Ehrenberg nun eine „Empfehlung zur Steigerung der Ärzteeinkommen“ vor und dringt auf einheitliches Auftreten der Pflichtkassen:
„Wir haben für diese gemeinsame Empfehlung, die ja wiederum Ärzte und Krankenkassen gemeinsam erarbeiten, fünf Kriterien vorgesehen, und zwar: die Entwicklung des durchschnittlichen Bruttoarbeitseinkommens, die durchschnittliche Grundlohnsumme der Krankenkassen, die Einkommen der mit den Kassenärzten vergleichbaren Berufsgruppen, die zu erwartende Entwicklung der Praxiskosten, der Arbeitszeit und eine mögliche Ausweitung der ärztlichen Leistungen durch Gesetz oder Satzung. Mit Hilfe dieser Daten müßte es Kassen und Ärzten doch möglich sein, die richtige Erhöhung der Vergütungen ausfindig zu machen.“ (Spiegel, 8/77)
Die Ärzte, die an der gesellschaftlichen Notwendigkeit medizinischer Versorgung gerade deshalb so gut verdienen, weil sie keine Beamten sind, ihre Allgemeinaufgaben freiberuflich erfüllen, und weil der Staat durch die Medizinerausbildung dafür sorgt, daß es immer zuwenig Ärzte gibt, wollen sie sich vom Staat nicht ein mal „Empfehlungen“ geben lassen. Sie, die bislang auch ohne staatliche „Empfehlungen zur Steigerung ihres Einkommens“ für dessen profitliches Gedeihen gesorgt haben, wittern hinter Ehrenbergs Plänen einen Anschlag auf ihre Freiheit beim Vergrößern des Reibachs. Minister Ehrenberg hat mit dem Bewußtsein der Ärzte im Umgang mit dem Patientenmaterial kein Problem, er will sie lediglich kostenbewußter machen. Sie sollen in Zukunft beim Verschreiben von Pillen und Salben ähnliche Tugenden walten lassen, wie sie jede Hausfrau aufbringen muß: das billigste Angebot wählen und kostenbewußte Rezepte ausschreiben: „Bonn (will) die Mediziner zwingen ..., den Medikamentenkonsum in Grenzen zu halten. Vorgesehen ist ein simpler Mechanismus: Arzte und Kassen einigen sich in einer gemeinsamen Empfehlung auf einen Betrag, um den in einem Kassenbezirk die Ausgaben für Arzneimittel steigen sollen. Grundlage sind die Aufwendungen des vorausgegangenen Jahres, überschreiten die Arzte dieses Limit, dann bekommen sie die Mehrkosten von ihrem gemeinsamen Honorarfonds abgezogen. Für den Präsidenten der Bundesärztekammer sind die Folgen klar, er prophezeit: »Der Kassenpatient kann nur noch das billigste Arzneimittel bekommen.«“ (Spiegel, 8/77) Rot vor Wut, hier könnte an ihrem Einkommen gekratzt werden, entdecken die Ärzte plötzlich das Wohl des Patienten, dem die billige Medizin nicht bekommen, bzw. die teure fehlen könnte, und drohen mit der zu erwartenden Entscheidung der Medizinmänner, die im Konfliktfall todsicher gegen den Patienten ausfallen dürfte: „Der Arzt sagt sich: Ich denke gar nicht daran, von meinem Honorar auch noch die Medikamente für die Patienten zu bezahlen. Er wird dann eben wieder Halswickel und Brustwickel verschreiben.“ (SPIEGEL, 6/77)
Kostensenkung im Krankenhaussystem Wird ein pflichtversicherter Bürger von den bestimmten ,,Wechselfällen“ des Lebens zu stark gebeutelt, kommt er ins Krankenhaus. Weil hier der „kostenintensivste Teil des Gesundheitswesens“ unterhalten werden muß, unterliegt das Krankenhaussystem im wesentlichen staatlicher Regie. Im öffentlichen Krankenhaus ist die gleiche medizinische Versorgung aller Patienten gewährleistet, was allein schon der Charakter der dort behandelten Fälle erforderlich macht (es gibt halt keine Blinddarmoperation 1. und 2. Klasse). |
|
|
Die Krankenhausärzte, die als Lohnabhängige von den pekuniären Möglichkeiten ihrer freiberuflichen Kollegen keinen Gebrauch machen können – sie müssen jeden Patienten medizinisch gleich behandeln – bekommen die Besonderheit des Arztberufs zu spüren: keine geregelten Arbeitszeiten – Infarkte kennen keine Dienstzeit – und permanente Konfrontation mit behandlungsintensiven Symptomen. Um dieses Personal überhaupt in ausreichender Anzahl zu kriegen, verpflichtet der Staat jeden Arzt zum Krankenhausdienst als Teil der medizinischen Ausbildung (Approbationsordnung). Beim Pflegepersonal nutzt er caritative Einrichtungen (Orden) aus. Erst in den höheren Rängen, wo die „Halbgötter in Weiß“ wirken, räumt er den Ärzten die Möglichkeit einer für sie segensreichen Verbindung ihrer Kunst mit finanziellen Vorteilen ein, indem er den Chefärzten den Unterhalt von Privatstationen gestattet, wo privat liquidiert wird und folglich auch nur Privatpatienten gepflegt werden. So sorgt er dafür, daß das Niveau der medizinischen Versorgung nicht durch ein ständiges Abwandern ausgebildeter Ärzte aus den Krankenhäusern in Privatpraxen und Kliniken gefährdet wird. (Eine Abschaffung der Chefarztpfründe impliziert die Verstaatlichung des gesamten Gesundheitswesens wie der Fall Großbritannien zeigt, wo als Konsequenz britische Ärzte das Land verlassen und durch schwarze Weißkittel aus den Commonwealth-Ländern ersetzt werden, was dem englischen Gesundheitswesen neben den üblichen Problemen kapitalistischer Krankheitsfürsorge noch ein handfestes Rassenproblem eingetragen hat, das die reaktionären Gegner des National Health Service weidlich ausschlachten.) Ehrenbergs Vorschläge zur Reform des Chefarztprinzips zielen demnach auch nicht auf eine Abschaffung ihrer Privilegien, sondern auf die Erweiterung des Kreises der von ihnen profitierenden Krankenhausärzte. Alle approbierten Ärzte in den öffentlichen Kliniken sollen die ambulante Behandlung von Patienten durchführen dürfen, „sofern das Krankenhaus bescheinigt, daß dadurch die Arbeit im Krankenhaus nicht beeinträchtigt wird.“ (FAZ). Da diese Regelung nur an Orten gestattet ist, an denen die ambulante Versorgung nicht durch niedergelassene Ärzte sichergestellt ist, Städte somit herausfallen, geht diese Maßnahme, soweit sie durchgesetzt werden kann, zu Lasten der Krankenhauspatienten, die den Service ihres ärztlichen Personals nun mit der Ambulanzklientel teilen müssen. Wenn Ehrenberg sich Konkurrenz für die freien Ärzte erhofft und eine bessere Auslastung der technischen Kapazitäten der Kliniken verspricht, gibt er zwar zu, daß die niedergelassenen Ärzte noch mieseren medizinischen Service bieten als die Krankenhäuser, trägt aber nichts zur Verbesserung des Gesundheitswesens bei, weil die stärkere Belastung des Klinikpersonals nur zu einer Niveauangleichung nach unten führen kann. Dafür sorgt auch die geplante Einführung einer Investitionsbeteiligung der Krankenhäuser bei Neubauten und bei der Anschaffung technischer Geräte (mindestens 10% bzw. 5%), womit die Krankenhäuser dem Rentabilitätsprinzip unterworfen werden sollen, was aber nur geht, wenn die Patienten um 10% schlechter behandelt bzw. um den gleichen Prozentsatz mehr geschröpft werden.
Apotheken und Pharmaindustrie: Zufriedenheit mit dem „gewachsenen System“ Hier funktioniert das „gewachsene System“ so. gut, daß sich Ehrenberg mit dem Vorschlag an die Ärzte begnügt, sie sollten kostenbewußter verschreiben. Die Pillendreher machen also weiterhin ungestört ihren Schnitt. Die Apotheker haben durch die Zulassungsordnung von vorneherein ihr gesichertes Einkommen, sie brauchen nicht in Konkurrenz zueinander treten, ihr Absatz ist durch die Rezepte der Ärzte in ihrem Bezirk bereits gesichert. Begründet wird diese Regelung lustigerweise damit, daß Konkurrenz unter den Apothekern den Patienten schadet, weil die Apotheker dann versuchen müßten – auf Kosten der Qualität – Billigangebote zu machen. Auch für die pharmazeutische Industrie ist der ansonsten vielgepriesene Marktmechanismus verschoben. Die Krankenkassen zahlen, was der Arzt verschreibt. Die Pharmaindustrie konkurriert also nicht um den Käufer, sondern um den Verschreiber. An einer gedeihlichen Zusammenarbeit mit den Ärzten interessiert, verhätscheln die Vertreter die Ärzte mit Werbegeschenken, um die Produkte der Firma x an den Arzt und damit an den Patienten zu bringen. Daher richtet sich der Hauptteil der Forschungsanstrengungen der Pharmaindustrie nicht auf die Entwicklung neuer Medikamente, sondern auf die Erfindung von Konkurrenzpräparaten zu bereits vorhandenen, häufig verschriebenen Arzneimitteln.
Bündnispartner und Gegner Wo es darum geht, den Schaden der Opfer des Gesundheitswesens, der durch die staatlichen Reformpläne vergrößert wird, vom Standpunkt des Staates zu diskutieren, ist natürlich der DGB auf den Plan gerufen. Er bedauert „in einer ersten Stellungnahme, daß die Regierung dem »gebauten Ansturm der Interessengruppen« nachgegeben und den Entwurf zur Kostendämpfung so abgeschwächt habe, daß »nachhaltige Auswirkungen auf eine Reduzierung der Kostenentwicklung fraglich« seien.“ (Nürnberger Nachrichten vom 17.2.77) Die Interessenvertretung der Arbeiter, die einmal die staatliche Gesundheitsfürsorge erkämpft hat, sorgt sich heute nur noch darum, ob sie dem Staat nicht zu teuer kommt. Wer so den Umstand, daß das Arbeitsvolk immer öfter zum Arzt gehen muß, in ein Kostenproblem verwandelt, macht sich zum Bündnispartner des Staates, der eben wieder demonstriert hat, daß ihm die Gesundheit seiner arbeitenden Bürger scheißegal ist, solange ihn die Reparatur ihrer Arbeitskraft nicht zuviel Geld kostet. Findet Ehrenberg bei den Opfern einen Bündnispartner, so stößt er bei den Nutznießern staatlicher Gesundheitspolitik auf einen erbitterten Gegner. Die organisierten Ärzte streikten bereits gegen die Ankündigung der Reform und agitieren ihre Patienten in Zeitungsanzeigen im Namen ihrer Gesundheit, wobei die meineidig gewordenen Streikärzte im Raum Hannover selbst noch ihren ausgesperrten Patienten in der Pose selbstloser Jünger des Hippokrates kommen, denen es ums Geld nur im Interesse der Kranken geht: „Es soll kontrolliert werden, ob es sich gelohnt hat, Geld für Ihre Gesundheit auszugeben. Darum werden Ihre Untersuchungsdaten zentral gespeichert. Der Weg in die Einheitsversicherung droht durch Gleichschaltung aller Leistungen für alle. Unter den Krankenkassen wird es den Wettbewerb nicht mehr geben, der zum heutigen Stand der medizinischen Versorgung beigetragen hat. Das, was Sie Ihre persönliche Versicherung (!) nennen, wird nicht mehr respektiert.“ |
Die „Kritik“ der Öffentlichkeit
Die Öffentlichkeit reagiert auf die handfestesten Sauereien der Ärzte, mit denen diese ihre gesellschaftliche Stellung, auf die jeder angewiesen ist (dies haben Ärztekritiker schon zu spüren bekommen, im wahrsten Wortsinn!), schamlos ausnützen, mit der Beschwörung des Ideals vom Arzt gegen die Praxis des Arztberufs. Man stürzt sich auf einen Sewering, um den „normalverdienenden“ Arzt (lumpige 120.000 DM im Jahr) ins rechte Licht zu rücken. Ein aufopfernder Arzt muß auch gut bezahlt werden, ist der Tenor und d.h.: wenn die Gesundheit einen Preis hat, dann muß er bezahlt werden – an den Arzt. Die Bildzeitung steht denn auch nicht an, gleich zwei Sauereien zum Lob der Mediziner anzuführen:
„Weiße Götter? Die Wirklichkeit ist grauer. Denn es gibt viel Arbeit, eine bleierne Last der Verantwortung und immer mehr Patienten, auch solche, die gar nicht krank sind. Viele Menschen haben einfach nur Angst und wollen getröstet werden. So gehen sie zum Doktor. Der Arzt ist heute oft auch Seelenarzt. Das ist mehr als ein Beutelschneider.“ (Bild vom 10.2.77)
| Eine weitere Masche des sozialen Netzes, die Arbeitdosenversicherung, haben wir in MSZ Nr.9/1976 in dem Artikel „Das Recht auf Arbeit – Wie der Staat den Arbeitslosen dazu verhilft“ einer Würdigung unterzogen. |
aus: MSZ 16 – April 1977



