Kapitalismus in Japan
Das gelbe Wirtschaftswunder
Die Japaner sind schon ein seltsames Volk. Da bilden sie eine Wirtschaftsmacht sondersgleichen und auf Schritt und Tritt stolpert man über ein Produkt mit so fremdländischen Zeichen darauf – von ihnen hört man aber, daß sie unter den bescheidensten Verhältnissen leben, dem Kamikaze-Sport huldigen, sich Festmähler aus dem Verspeisen giftiger Fische machen. Dieses Tokio ist ein gigantisches Dorf mit ein paar durchgebrochenen Hochstraßen, die Wohnungen bestehen aus Pappe und Bambus –
„Für den gewöhnlichen Salaryman ist Wohnen keine sehr schöne Angelegenheit, eng ist es und es stinkt aus der Sickergrube – nur jedes fünfte Haus ist in den Großstädten an eine Kanalisation angeschlossen. Die Wohnungen sind schlampig gebaut, die Wände sind aus Pappe oder imitiertem Stein, auf dem Dach ist Blech.“ (II, 44) –,
in denen sie auch noch auf jegliche Privatheit verzichten: Oma und Opa sind selbstverständlich immer dabei, und wenn Papi und Mami mal wollen, gehen sie in ein öffentliches Love-Hotel. Heiraten ist auch keine Sache von Liebe und freier Entscheidung –
„Wenn er 30 wird, ist es höchste Zeit für Herrn Nakamura zu heiraten ... Eigentlich könnte er sich noch keine Ehe leisten, aber die japanischen Firmen erwarten das von ihren Salarymen: Die Ehe wird als stabilisierender Faktor betrachtet, und ein unverheirateter Mann hat kaum Chancen, aufzusteigen.“ (II, 42)
und Freizeit kennen sie schon deswegen nicht, weil sie keine haben; wenn sie welche hätten, kein Geld dafür haben; wenn sie beides hätten, die üblichen Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen, nicht existieren – es sei denn als gut ausgebaute Bordellstraßen. Der Staat tut nichts in dieser Hinsicht, so daß im Verein mit dem nichtvorhandenen Geld der Besuch eines Kaufhauses nicht um des Kaufens willen geschieht, sondern eine Bildungsreise darstellt –
„Mitsukoshi leistet man sich wie einen Theaterbesuch oder eine Bildungsreise. Mitsukoshi bedeutet Genuß, Gehobensein, Gleiten im Luxus, Empfindungen, die auch teilen kann, wer nicht kaufen mag (?)“ (II, 52) –,
und überhaupt ist dieser Staat ein einziges Provisorium, der nicht einmal ein funktionierendes Stromnetz zustande bringt und statt die U-Bahn auszubauen, „Drängler“ einstellt, also kräftige Männer, die die Massen morgens und abends in die überfüllten Waggons pferchen. Da wundert es niemand, daß die ganze Familie darauf spart, einen der ihren mal zu einem Urlaub ins Ausland schicken zu können, wo er dann wie ein Teufel knipsen muß, um 20 Jahre lang Diaabende über eine andere Welt veranstalten zu können. Die japanische Verrücktheit, solche Umstände zu ertragen, paart sich jedoch nicht zufällig mit ihrer Gefährlichkeit. |
 |
Zur 2. Wirtschaftsmacht des Westens sind sie aufgestiegen –
„Das 21. Jahrhundert, sagt der amerikanische Zukunftsforscher Hermann Kahn, ist das Jahrhundert Japans“(*1) (II, 22) –,
also dem hiesigen Wirtschaftsfortschritt ein mächtiges Hemmnis geworden.
Die TOYOTA-Männer
Daß die Verrücktheit und Gefährlichkeit der japanischen Wirtschaft sich der besonderen Zurichtung der japanischen Arbeiterklasse verdankt, deutet folgender neidvoller Hinweis an:
„Die hohe Leistungsmotivation, Tüchtigkeit und Fleiß, Bescheidenheit und Sparsamkeit, alles das sind Tugenden, die in Deutschland in den letzten Jahren mehr und mehr verlorengegangen sind und weiterhin abzunehmen scheinen. Allein die betriebliche Fluktuation der Belegschaften, also das Gegenstück zur japanischen Arbeitsplatztreue, die Häufigkeit der Krankmeldungen und Feierschichten, das Nachlassen der Arbeitsdisziplin und die unaufhörliche Steigerung des Anspruchsniveaus lassen die heutige deutsche Wirtschaftsmentalität im Vergleich zu Japan ungünstig abschneiden.“ (XXI, 44 f.)
Diese so hochgelobten Tugenden des japanischen Arbeitsvolkes sind Ergebnis eines brutalen ökonomischen Zwangs, der ihnen strikteste Selbstbeschränkung als einzigen Weg, ein gerade noch aushaltbares Leben zu führen, vorschreibt. Das „System der Beschäftigung auf Lebenszeit“ zwingt denjenigen, der des relativen Vorteils dieses Systems teilhaftig wird, nämlich nicht sofort vor der täglichen Aussicht des Krepierens zu stehen, zu irrsinnigen Anstrengungen, die er unternimmt, um nicht dem Schicksal des Teils der Arbeiterklasse, der nicht durch dieses System „gesichert“ ist, anheim zu fallen, im Resultat zu der genau gleichen Vernutzung und Existenzvernichtung führen.
Die Formen des Bewußtseins, die diesem Zwang entspringen –
„Wird das westliche Denken vom individuellen Streben nach Glück geformt, so strebt in Japan der Mensch nur in Gruppen nach Glück, nach kollektivem Glück. Er unterwirft sich der Gruppendisziplin, auf daß in seiner Gruppe Harmonie herrsche“ (II, 23) –
sind zwar keineswegs der Grund dafür, daß der japanische Arbeiter sich seine Misere gefallen läßt, dafür aber umso wirkungsvolleres Mittel, es in solchen Verhältnissen auszuhalten, weshalb ihm seine von traditioneller Lebensart geprägten Verkehrsformen und Ideale geradezu lieb und teuer sein müssen.
Willig unter Zwang ...
Die Arbeiterklasse existiert in zwei Teilen: dem Stammarbeiter und dem Zeitarbeiter. Der Stammarbeiter muß sich die relative Sicherheit seiner Existenz um den hohen Preis der beliebigen und lebenslangen Vernutzung seiner Arbeitskraft erkaufen.
„... Der Arbeitnehmer (sucht) heute Sicherheit innerhalb des Unternehmens, dem er meistens von der Ausbildung bis zur Pensionierung angehört. Der Sozialstatus wird dabei von der Arbeitsstätte und nicht vom Beruf verliehen. So gibt es wenig Einwände gegen Automation, Umschulungen und Berufswechsel, da alle Änderungen zum Nutzen des Unternehmens notwendig sind, und das Großunternehmen in seiner Daseinsfürsorge zahlreiche nicht-geldliche Leistungen bietet. Die lebenslange Anstellung begründet Arbeitsdisziplin und Leistungswillen...“ (Lexikonauszug, S. 1)
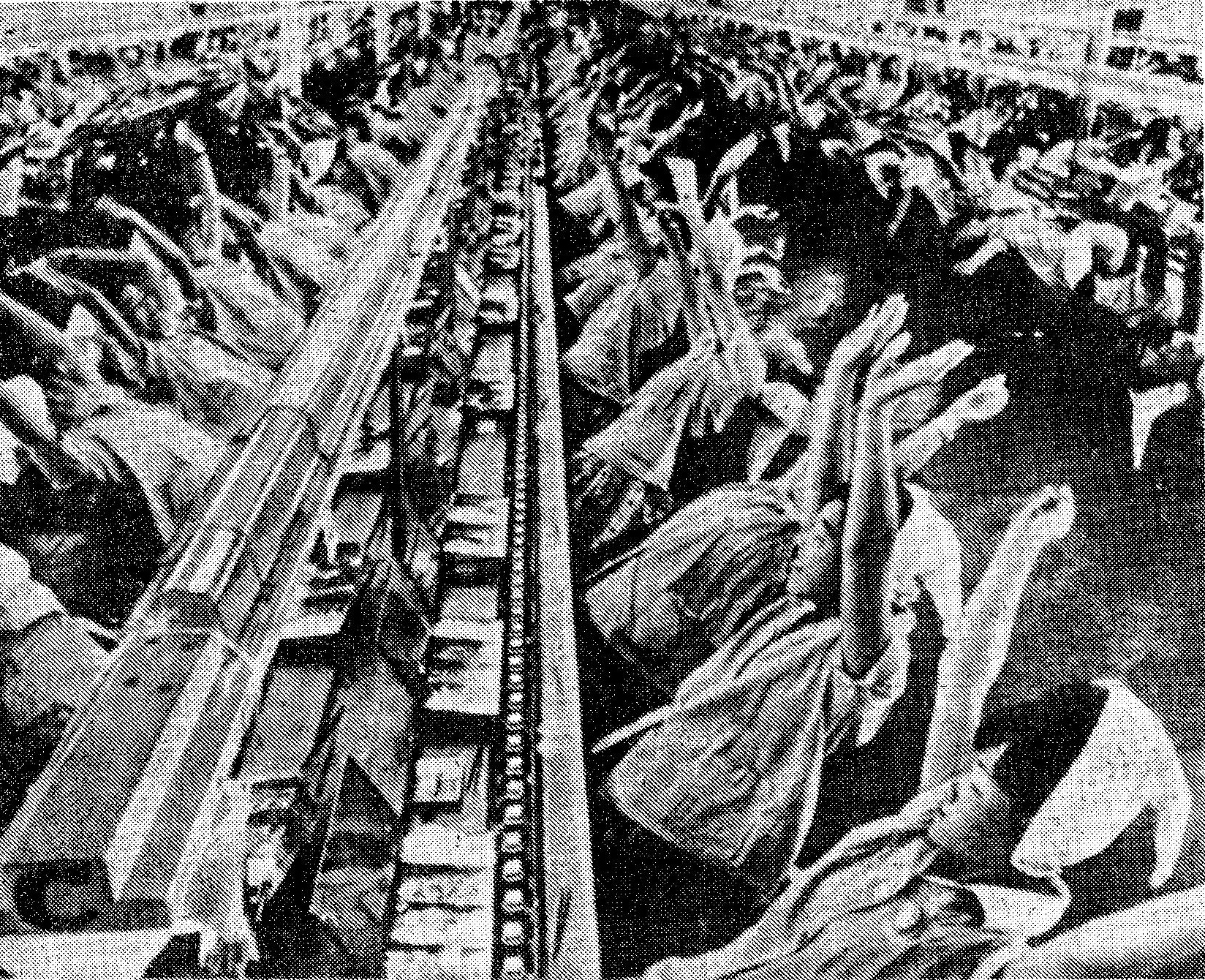 |
Wem es also gelingt, sich mit Haut und Haaren an ein Unternehmen zu verkaufen, wer Stammarbeiter wird, der muß sich darüber im klaren sein, daß nichts, was das Unternehmen mit ihm anstellt, ihm was ausmachen darf – Hauptsache, es ist zu dessen Nutzen. Schließlich kriegt er dafür nicht nur lebenslänglich Arbeit, und damit eine relative Sicherheit, sondern auch noch die „betriebliche Daseinsfürsorge“ verpaßt. |
... oder zwanglos verhungern
„Betriebliche Daseinsfürsorge“ heißt, daß die großen Betriebe bei ihren Stammarbeitern dafür sorgen, daß diese für den betrieblichen Zweck funktional bleiben, was natürlich ein betriebswirtschaftlich äußerst rationelles und von keinerlei volkswirtschaftlichem Räsonnement getrübtes Unterfangen ist. Dennoch ist für den Stammarbeiter diese Art, mit der mit ihm umgesprungen wird, ein Privileg im Verhältnis zum Zeitarbeiter, bei dem sich keiner mehr um seine Tauglichkeit, also Vernutzbarkeit, Gedanken macht. Die Wahnsinnskalkulation, die ein japanischer Arbeiter also mit sich veranstaltet, ist: lieber dem manifesten Zwang des Betriebs unterworfen sein, als zwanglos zu verhungern:
– Der Stammarbeiter (und nur er) erhält bei seinem Ausscheiden aus dem Betrieb, meist mit 55, eine betriebliche Altersrente von 30 - 40 Monatslöhnen, die ihn vor der unmittelbaren Not nach einem arbeitsreichen Leben bewahrt.
– Mangels sonstwie beschaffbarer Wohnungen bieten die Großfirmen ihrer Stammarbeiterschaft billige Betriebswohnungen an – betriebliche Wohnheime für Ledige und kleine Wohnungen für Verheiratete –.wobei die betriebsnahe Kasernierung der Belegschaft kaum als solche erscheint, weil die Alternative ein winziges und teures Loch ohne Strom und Kanalisation unter den berühmten Hochstraßen Tokyos ist.
Die Alternative zum Krepieren, kaum daß eine etwas schwerwiegendere Krankheit sich einstellt, ist, sich der ausschließlichen Obhut der Betriebsärzte und -kliniken zu unterstellen, die naturgemäß mit dem Begriff „Arbeitsfähigkeit“ noch virtuoser umgehen, als der skrupelloseste, staatlich anerkannte Gesundschreiber.
– Auch die Aufzucht eines gesunden Proletennachwuchses wird betrieblich gesichert durch Zulagen für Verheiratete und Kinder, durch Kindergärten, Schulen, Sportanlagen etc.
– Und wenn einer keinen Ehepartner findet, und so die Gefahr besteht, daß er seinen Beitrag zur Vermehrung der künftigen japanischen Arbeiterschaft nicht leistet?
„Die Firma sorgt dafür, daß die Belegschaftsmitglieder nicht lange ledig bleiben. Als Heiratsvermittler fungieren die Vorgesetzten. ...geheiratet wird in der firmeneigenen Hochzeitskapelle.“ (II, 34)
Nichts zum Leben und zum Sterben zuwenig
Diese Sozialleistungen der Großunternehmen für ihre Stammarbeiterschaft machen einiges über die Situation der japanischen Proleten klar: zum einen zeigen sie, was sich der Arbeiter, der den Sprung in die privilegierte Stellung des Stammarbeiters nicht geschafft hat, alles nicht leisten kann – sogar das Sterben ist für den Teil der Proleten eigentlich zu teuer, denn nicht umsonst erhalten die Stammarbeiter Zulagen bei Geburts- und Sterbefällen von ihrem Betrieb.
Weil die betrieblich gebotene Existenzsicherung davon abhängig ist, daß man sich als Stammarbeiter bei Toyota, Honda, etc. bewährt, ist die völlige Identifizierung mit dem Betriebszweck Voraussetzung für den Erhalt der Privilegien.
„Diese Beziehung zwischen Betriebsführung und Angestellten ist eher vergleichbar einer Beziehung, die durch Schicksal bestimmt ist, als einem zwischen Betriebsführung und Angestelltem abgeschlossenen Arbeitsvertrag.“ (III, 133)
„Bei Arbeitsantritt kriegt man als erstes ein Firmenzeichen ans Revers gesteckt. Und das trägt man bis zum Tode,“ (Spiegel 27/1976) (Die Assoziation zur Brandmarkung von Rindern ist nicht zufällig)
aber nur wenn er es schafft, für die Zugehörigkeit zur Stammarbeiterschaft seinen Nutzen ganz in dem des Betriebs aufgehen zu lassen. Er muß Toyotamann werden, bereit sein, sein ganzes Leben auf die Anforderungen der Firma an ihn abzustellen, bis spät in die Nacht zu arbeiten an jedem Platz, an dem Toyota ihn hinstellt. Er ist ein Lohnsklave, der sich selbst diese Aufgabe seines freien Eigentümerdaseins beschert unter dem Druck dessen, was ihm ansonsten blühen würde. Der Vorzug, eine Wohnung mit notwendigstem Komfort, einen Arzt, wenn man krank ist und eine minimale Rente zu haben, ist in Japan nur um den Preis völliger Hingabe an den Betrieb zu erhalten. Der Stammarbeiter muß sich jeden Anspruch an den Betrieb aus dem Kopf schlagen – er darf nur Ansprüche des Betriebs an sich kennen. So steht ihm zwar rechtlich ein jährlicher Urlaub zu –
„Mindestens 6 Tage bei einer mehr als einjährigen Beschäftigungszeit und Wahrnehmung von mindestens 80% der jährlichen Arbeitstage. Pro weiterem Beschäftigungsjahr steigt der Urlaub um jeweils einen Tag bis zur Höchstgrenze von 20 Tagen.“ (I, 226) Aber: „Es gilt als unfein (!) mehr als ein Drittel des gesetzlichen Urlaubs auch wirklich zu nehmen.“ (IV) –,
was für den Stammarbeiter heißt, seinen Urlaub eben erst mit der Rente anzutreten.
Lohn für langjähriges Opfertum
Die Stammbelegschaft unternimmt deshalb alle Anstrengungen, sich in Sachen Opferbereitschaft für ihr Unternehmen zu überbieten, um nicht als unwürdiges Element aus ihr entfernt zu werden. Hohe Leistung allein qualifiziert dabei noch lange nicht zum Stammarbeiter, sondern darüberhinaus Leistungsbereitschaft, die nichts für sich verlangt. So blühen in japanischen Unternehmen Sachen wie das Vorschlagswesen, in dem die Arbeiter ihre Einsatzbereitschaft, demonstrieren können. Prämiert werden dann nützliche Vorschläge wie – man sollte doch die Taschen an den Arbeitsanzügen weglassen, weil diese zum Nichtstun verführen.
Daß ein Stammarbeiter täglich Höchstarbeitsleistungen bringt, ist immer unterstellt und die Profilierung als Stammarbeiter zeichnet sich v. a. in Sachen Idealismus aus:
„Den ganzen Tag lang hockt er über seinen Schreibtisch gebeugt, und spät am Abend erst knipst er seine Bürolampe aus. Er könnte auch früher nach Hause gehen. Aber das tut er nicht, denn er unterliegt dem Zwang der Masse (ach so!). »Käme ich früher heim als alle anderen, würden die Nachbarn denken, meiner Firma gehe es schlecht und mein Job sei unsicher.«“ (II, 38)
Daher leisten sich die Japaner auch eine ganz spezielle Form der Entlohnung; die westliche Illusionen, daß im Arbeitslohn die eigene Leistung bezahlt werde, gar nicht erst aufkommen läßt. Der japanische Großbetrieb entlohnt nach dem „Senioritätsprinzip“: Allein die Länge der Zugehörigkeit zum Betrieb macht die Höhe des Lohns aus, so daß tatsächlich die treue Aufopferung Maßstab des Arbeitslohns ist. Dieser wird ergänzt durch die sozialen Leistungen und Bonuszahlungen, die abhängig sind von Größe und Gewinnlage des Unternehmens und in vielen Fällen bis zu 60% des Lohns ausmachen. Mit dieser Form der Entlohnung, die natürlich nicht tariflich gesichert ist, schlägt der japanische Unternehmer gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Da der ausgezahlte Arbeitslohn nur ca. 40% des gesamten Lohns ausmacht und die Bonuszahlungen vom Profit des Unternehmens abhängen, zwingt er seinen Arbeitern die Gleichung – „wenn es meinem Betrieb gut geht, geht's mir etwas besser“ – praktisch auf, so daß er sich ihrer Höchstleistungen sicher sein kann und zugleich ein Interesse seiner Arbeiter an einem niedrigen Normallohn erzielt hat – sonst ist ja mit niedrigerem Profit auch der Bonus, den man so notwendig braucht, niedriger. Zum zweiten bindet er den Teil des Lohns, der als Bonus ausgezahlt wird, daran, daß das Unternehmen mit der erbrachten Arbeitsleistung auch Profit erwirtschaftet hat – wenn nicht, gibt's nichts und die Belegschaft hat umsonst geschuftet.
Gewerkschaftlicher Kampf als Ritual zur Selbsterhaltung
Die Gewerkschaften, als Betriebs-, d.h. Stammarbeitergewerkschaften organisiert, tun zum einen nichts anderes als ihre Mitglieder –
Ihre „Tarifverträge wiederholen meist nur die gesetzlichen Bestimmungen (Urlaub, Arbeitszeit, Zuschläge für überstunden etc) und geben über Löhne nur allgemeine Richtlinien. Die Gewerkschaften fordern auch nie feste Stundenlöhne, sondern je nach Ertragslage eine prozentuale Steigerung der Gesamtlohnsumme des betroffenen Betriebes.“ (III, 147)
Und überhaupt: nur knapp die Hälfte aller Tarifverträge enthalten überhaupt Lohnvereinbarungen, in allen anderen Fällen
„bleibt die Festsetzung der Entlohnung ... den vom Arbeitgeber aufzustellenden Beschäftigungsbedingungen vorbehalten.“ (I, 177)
Die Betriebsgewerkschaft ist „eine effektive Hilfe bei der Bewältigung solcher Fragen wie technische Reformen, Neuinvestitionen, Geschäfts- und Produktionsrationalisierungen und Personalverschiebungen in einem Unternehmen“ (V, 44) –,
also stillhalten und die Produktivität steigern; zum anderen legen sie jedoch durchaus eine gewisse Militanz an den Tag, und zwar in einzelnen Streiks – in denen es nicht um Lohn geht – und in ihrer nationalen „Frühjahrsoffensive“. Diese Militanz dringt jedoch nicht auf eine Verbesserung des Loses des Stammarbeiters, sondern darauf, einer bleiben zu können. Immer wieder kommt es zu heftigen Kontroversen, nämlich wenn die Unternehmer das „System der Beschäftigung auf Lebenszeit“ ankratzen, also am Status des Stammarbeiters drehen. Hierauf dringt die Gewerkschaft auf die öffentliche Versicherung beider Seiten, daß dieses „System“ doch eine gesellschaftlich anerkannte, nützliche und dem japanischen Volkscharakter entsprechende Einsicht sei – und die ,,Frühjahrsoffensiven“ haben darum zumeist einen mehr rituellen Charakter, der auf die feierliche Beschwörung dringt, daß Japan bleibt, was es ist. Selbst der äußerst relative Vorteil, den der Stammarbeiter aus seinem Dasein zieht, ist den Unternehmern in manchen Situationen noch ein Dorn im Auge, und ihre unumschränkte ökonomische Macht zeigt sich darin, daß sie selbst an diesem, für sie absolut vorteilhaften Mittel der Aufteilung der Arbeiterklasse hin und wieder noch Verbesserungen durchführen können dergestalt, daß sie diese Aufteilung zeitweilig durchlöchern und die Empörung der Stammarbeiter lässig in Kauf nehmen. Insbesondere sie hier nicht auf ihre Mafia, die Yakuza-Gumis, zurückgreifen können, die auf Streitigkeiten im Arbeitsleben spezialisiert sind und Probleme menschlicher Natur, wenn ein Gewerkschaftler sich allzu renitent zeigt, dezent auszuräumen verstehen.
Der Dorn, den die Stammarbeiter fürs Kapital darstellen, in gewissen konjunkturellen Situationen, wo Entlassungen anstünden, unkündbar zu sein, verliert an Schärfe durch die diversen Handhabungsmöglichkeiten wie Versetzungen, Streichung von Bonuszahlungen, simplem Steigern des Anforderungsniveaus, hat darüberhinaus aber seine sichere Gewißheit, daß er nie zu einem schmerzlichen Hemmnis wird, darin, daß sich alle Schwierigkeiten, die dem Kapital notgedrungenermaßen immer wieder mit seinem Ausbeutungsmaterial entstehen, reibungslos und in letzter Konsequenz auf den anderen Teil der Arbeiterklasse abwälzen lassen. Manche Einschränkungen des Status des Stammarbeiters lassen sich nicht durchführen, ohne das „System“ selbst in Frage zu stellen. Daß die Prophezeiungen eines baldigen Endes einer privilegierten Stammarbeiterschaft seit 1968 zu hören sind und doch heute die Stammarbeiterschaft Japans wie eh und je existiert, verweist auf die andere Seite der Unternehmerkalkulation: die Beibehaltung der schlecht reduzierbaren Kosten der Stammarbeiterschaft basiert darauf, daß die komplementären Kostensenkungen an anderer Stelle vorgenommen werden können. Und dafür gibt es das Heer der japanischen Zeitarbeiter, die die gleiche Arbeit wie Stammarbeiter für weit weniger Lohn verrichten, keine betrieblichen Sozialleistungen erhalten und gemäß den Bedürfnissen der Firma eingestellt und entlassen werden, was den Gewerkschaften wie den betroffenen Arbeitern eine Selbstverständlichkeit ist: Sie sind eben die Arbeiter 2. Klasse, die, die's nicht geschafft haben, Stammarbeiter zu werden, und sie sind, im Unterschied zu diesen, im Besitz all der schönen Freiheiten, die der Kapitalismus einem Arbeiter so zu bieten hat.
Eine produktive Reservearmee
Der Zeitarbeiter ist in jeglicher Hinsicht frei: frei vom Ballast des Eigentums, frei von sozialer Unterstützung und v.a. frei im Verkauf seiner Arbeitskraft – er darf, sprich muß, wenn er nicht vor die Hunde gehen will, denn von der staatlichen Arbeitslosenhilfe kann man auch nicht notdürftig leben, in aller Freiheit seine Arbeitskraft verkaufen – weshalb jeder Zeitarbeiter diese ihm aufgezwungene Freiheit verwünscht und kein höheres Ziel hat, als sie aufzugeben und dafür leben zu können. Denn die Konkurrenz unter seinesgleichen ist groß und die Zeitarbeitern zur Verfügung stehenden Arbeitsbereiche begrenzt. In Großunternehmen kommen sie als Hilfskräfte an, sofern und solange dort zusätzliche Arbeitskräfte benötigt werden, und daneben gibt es nur die Masse der Zulieferbetriebe, die sich keine Stammarbeiter leisten können. Hier hat der Zeitarbeiter, der den Zwang der Verhältnisse, seine Arbeitskraft zu jeder Bedingung verkaufen zu müssen, um nicht draufzugehen, als seine ihm zukommende Pflicht und Aufgabe für die Größe Nippons akzeptiert, seinen Platz als williges Ausbeutungsmaterial, das die Kostenkalkulation der Großunternehmer, die ihre Kostensenkungen mittels der Klein- und Kleinstunternehmer durchsetzen und diese so für ihren Profit benützen, solange ihre Preise stimmen, noch immer aufgehen läßt. Denn die Existenz dieser Minibetriebe, der permanenten Preisdrückerei ihrer Abnehmer ausgesetzt, hängt davon ab, ob sie aus ihren Arbeitern so viel rausholen können, daß sie dem Preisdiktat der Großen auch nachkommen können.
„Ohne Rücksicht auf Verluste werden die Preise der Zulieferer gedrückt. »Wir können«, sagt Sony-Zulieferer Kaoro Wakamatsu, »unseren Leuten nur noch mehr Arbeit für immer weniger Geld bieten« „ (11,36)
So heißen die Arbeitsbedingungen in einem kleinen Betrieb 14-15-Stundentag an 365 Tagen im Jahr bei möglichst hoher Arbeitsgeschwindigkeit, sonst schafft man die Bestellungen nicht, zu einem Lohn, der um die Hälfte unter einem Stammarbeiter-Lohn liegt, und natürlich gibt es kaum bis keine Sozialleistungen und Bonuszahlungen. Diese Arbeitsbedingungen der Zeitarbeiter sind neben ihrer eigenen Stammarbeiterschaft die Grundlage für die Größe und Konkurrenzfähigkeit der Großbetriebe.
Natürlich gibt es in Japan auch Arbeitsgesetze –
„Auf dem Papier setzte sich Japan an die Spitze der fortgeschrittenen Industrienationen, und seine Arbeitsgesetzgebung, die viele Konventionen der ILO enthält, könnte durchaus als Modell für andere Länder dienen.“
aber:
„Bei der Bestandsaufnahme fiel allerdings unter den Tisch, daß die Hälfte der Industriearbeiterschaft in kleinen Betrieben beschäftigt ist. Dabei gelten die Gesetze über Arbeitsbedingungen oder die anderen Arbeitsschutz Vorschriften für Betriebe nicht, die weniger als fünf ständig Beschäftigte haben. Ebenfalls sind die Zeitarbeiter wegen ihrer Arbeitsverträge, die es nicht gestatten, den Genuß der Schutzbestimmungen und Vorteile des Gesetzes zu erlangen, meistens gar nicht erfaßbar.“ (V, 115 f)
Und solange die Zeitarbeiter ihrer schrankenlosen Ausbeutung nicht durch gewerkschaftliche Organisierung einen Riegel vorschieben, sondern ihre Situation als Resultat ihres Versagens begreifen, weshalb es sich von selbst versteht, daß sie von ihrem Dienst an Japan gar keinen Vorteil mehr haben, solange werden die Arbeitsgesetze wohl des größeren volkswirtschaftlichen Nutzens einer elastischen und extensiven Ausnutzung der menschlichen Arbeitskraft wegen vergeblich auf ihre Anwendung harren.
Examen oder Harakiri
Da die Entscheidung darüber, welcher Proletenklasse man zugeordnet wird, in der Regel mit der ersten Anstellung fällt, geht die Konkurrenz in der Ausbildung bereits im zartesten Kindesalter los und verläuft in brutalen Formen. Eine japanische Kindheit ist deshalb ein ausgesprochenes Zuckerschlecken:
„Wenn er drei Jahre alt ist, beginnt für Nakamura junior der Ernst des Lebens, Jetzt hat er ein Jahr Zeit, sich für die Aufnahmeprüfung in eine gute Grundschule vorzubereiten, die in eine gute Oberschule fuhrt, die ihn in eine gute Universität bringt, und einen guten Start als Salary man garantiert.“ (II. 40)
Es genügt nämlich nicht, mit guten Noten durch die Schulzeit zu kommen, man muß es schaffen, mit guten Noten durch die guten Schulen und Universitäten zu kommen, wenn man in der Konkurrenz bestehen will. Was nützt schon ein College-Studium an einer nichtangesehenen Privatuni, wenn 50 % jedes Jahrgangs ein Grundstudium absolvieren und die Großunternehmen sich die Absolventen der besseres Unis als Stammarbeiterschaft raussuchen können?
„Jeder Universitätsabsolvent möchte am Glanz großer Firmennamen wie Mitsubishi oder Mitsui teilnehmen.“ (Spiegel, 27/1977),
und wer dort nicht ankommt, gehört zum akademischen Proletariat, auch wenn er in einem Kleinbetrieb Ingenieur oder Techniker ist.
Zudem ist der Kampf um eine Stammarbeiterexistenz nicht nur eine kinderaufreibende, sondern auch eine teure Angelegenheit: Die Unterbringung der Sprößlinge in guten Ausbildungsstätten kostet nicht nur Nachhilfelehrer, Arbeitstische mit eingebauter Uhr zur Einhaltung der Arbeitszeit und bei auftretenden Magengeschwüren Unterbringung in Spezialkliniken mit angegliederter Schule, sondern auch hohe Aufnahme- und Studiengebühren, da der japanische Staat sich die Finanzierung seines Ausbildungswesens dadurch erleichtert, daß er 1/3 aller Oberschüler, 90 % aller Collegiaten und 4/5 aller Studenten privaten Lehranstalten überläßt, so daß die häufige Überqualifikation der Leute, die aus dem allgemeinen Streben nach den Stammarbeitsplätzen resultiert, finanziell nicht ihm, sondern allein den Familien zur Last fällt. Damit kann eine 5 in Mathematik die endgültige Ruinierung nicht nur des eigenen Lebens, sondern der ganzen Familie bedeuten, weshalb ein Nebenprodukt dieses kindlichen Konkurrenzkampfes auf Leben und Tod die hohe Rate an Schülerselbstmorden ist – für Japaner eine nicht weiter beachtenswerte Angelegenheit –
„»Es ist eine Frage der stärkeren oder schwächeren Persönlichkeit«, erklärte ein Beamter des Erziehungsministeriums.“ II, 42)
Bringt sich bei uns ein Schüler wegen eines schlechten Zeugnisses um, packen vom Lehrer bis zur Tageszeitung alle ihre scheinheilige Kinderfreundlichkeit aus, und dem armen Wurm wird eine völlig falsche Reaktion auf sein Versagen attestiert; die Gesellschaft braucht schließlich auch Leute, die, zufrieden mit einem bescheidenen Platz in der Gesellschaft und mit einem entsprechend bescheidenen Gehalt, gute Dienste auf den unteren Rängen der Berufshierarchie leisten, es gibt also überhaupt keinen Grund, sich überflüssig vorzukommen, weil man das Abitur nicht schafft. Anders in Japan. Schreibt ein Schüler da in einem Abschiedsbrief
„Ich habe Mathematik nicht bestanden. Ich bin ein hoffnungsloser Kerl und will euch nicht zur Last fallen“,
dann ist das ein Erziehungserfolg. Dieser kleine Japs hat begriffen, daß sein Versagen in der Konkurrenz für einen Japaner eine nicht wieder gutzumachende Versündigung an seiner Familie und seinem Vaterland zu sein hat.
Das Vaterland in der Firma
Seine durchaus nicht freiwillige Betriebstreue ist ganz unmittelbar auch seine bedingungslose Unterwerfung unter den Staat. Alles dreht sich um die Größe Japans und seine Stellung in der Welt, die zu befördern der einzige Zweck einer Proletenexistenz zu sein hat:
„Dienst am Vaterland durch Fleiß, Gerechtigkeit, Harmonie und Zusammenarbeit, Kampf für eine bessere Zukunft, Höflichkeit und Demut, Anpassung, Dankbarkeit“ (II/33)
heißt das Glaubensbekenntnis, mit dem sie jeden Tag beginnen müssen. In allen großen Firmen werden die Arbeiter in einer täglichen ,,Morgenzeremonie“ auf die Treue zu „ihrer“ Firma und zu Japan eingeschworen, wobei man gleich mit der Praktizierung des Versprochenen beginnt: In Reihen aufgestellt (harmonisch angepaßt) knetet jeder seinem Vordermann mit Fleiß die Nackenmuskeln (Zusammenarbeit), dann werden die Firmengebote vorgelesen und im Chor nachgebetet. Es folgt ein Vortrag eines Arbeiters, in dem er an einem selbstgewählten Thema zeigt, daß er sich für eine bessere Zukunft einzusetzen gewillt ist:
„gestern abend hat die Mannschaft gewonnen, die über die bessere Grundausbildung verfügte. Auch bei unserer Arbeit ist eine bessere Ausbildung wichtig. Wir müssen besser sein.“ (II/33)
Abschluß und Höhepunkt des Ganzen bildet das Absingen der Firmenhymne, die sogar den Giftschlangen und Engerlingen fressenden Japanern den Magen umdrehen müßte:
„Für den Aufbau eines neuen Japans
laßt uns Kraft und Geist vereinen
zum Besten der höheren Produktion
Unsere Güter gehen hinaus in alle Welt
Wachse, Industrie, wachse, wachse, wachse!
Harmonie und Reinheit“ (Matsushita)
Der einzelne (her)unter dem Ganzen
So rackert sich der Japaner sein Leben lang ab, und der Verzicht auf jegliche Privatheit, der sie z.B. die Tortur der Love-Hotels –
„Die größte Zahl der Kunden sind Ehepaare. Daheim sind die Wände zu dünn, die Zimmer zu klein, und obendrein leben die Eltern oder Schwiegereltern auch noch im Haus“ (II/71) –
aushalten läßt, also die praktische Beseitigung der Illusion, man arbeite, um nachher ungestört sein kleines Glück gestalten zu dürfen, ist zugleich sein freudiges Aufgehen im Staatsganzen, und darin gewinnt er dann sein Glück –
„arm sein, das heißt unabhängig sein von den Dingen der Welt, Reichtum, Macht, Ansehen ...“ (rororo/14) – ,
solange Japans Staat und Kapital „Reichtum, Macht und Ansehen“ genießen. Das völlige Absehen vom materiellen Nutzen und totale Aufgehen im Dienst an Japan ist das Ideal der japanischen Gesellschaft,
„Gehorsam, Genügsamkeit, Fleiß, Treue sind die traditionellen japanischen Gesellschaftswerte“ (11/30).
Der Japaner anerkennt ideologisch, was materieller Zwang ist: daß seine Individualität völlig gleichgültig und bedeutungslos ist, er für Staat und Kapital nur als Mittel zur Mehrung des Reichtums der Nation und ihrer Stärkung zählt, und als solches hat er sich zu bewähren. Ein ordentlicher Japaner erachtet seine Person als viel zu gering, um für sich Glück und Wohlergehen zu erstreben –
„In Japan ist »Ich« immer gering, immer klein. »Geben Sie mir« heißt auf japanisch »heruntern Sie mir«“ (II/ 23)
Die im gesellschaftlichen Umgang der Leute praktizierten Verbeugungszeremonien
„Man verbeugt sich vor anderen Menschen tief, tiefer, am tiefsten. Mindestens dreimal, das gilt als flüchtig. Sechsmal ist die Norm.“ (13/23)
sind nicht ,,übertriebene Höflichkeit“, sondern nur ein Ausdruck davon, daß der Japaner keinerlei Wert auf die Anerkennung seiner Person legen darf, ihm also die Grundfeste des demokratischen Staatsbürgers gänzlich fremd ist – für „Individuum“ hat die japanische Sprache überhaupt kein Wort.
Wer sich als untaugliches Mitglied erweist und nicht in den Verdacht des Schmarotzertums kommen will, beweist seine Individualität darin, daß er mit sich selbst den letzten Grund der Unzufriedenheit mit beseitigt –
„Selbstmord gilt als moralisch hochstehende ehrenvolle Lösung persönlicher Probleme“ (Spiegel Nr. 26/77)
oder – etwas weniger dramatisch – untertauchen: 1977 verschwanden fast 100.000 Japaner, davon die Hälfte spurlos, 26.000 Leichen wurden nicht identifiziert.

Der SONY-Staat
Die Besonderheiten des japanischen Kapitalismus samt der diversen ,,fernöstlichen Rätsel“ sind dem interessierten Auge des westlichen Beobachters Anhaltspunkte, die Unerklärlichkeit dortiger Verhältnisse zu beschwören, weil es ihm auf den daraus folgenden Hinweis auf die Gefährlichkeit eines solchen Staates ankommt. Darauf kommt er jedoch nur, weil er einen. Vergleich mit seinem eigenen Staatswesen anstellt, und in diesem Vergleich ist eben unterstellt, daß es sich dort erst einmal um einen ganz gewöhnlichen Kapitalismus und dafür dienstbaren Staat handelt. Ganz offensichtlich hat es darüberhinaus das japanische Kapital verstanden, seine besonderen historischen Umstände nützlich für sich zu gestalten – was eben seine Gefährlichkeit ausmacht.
Der Staat als (liberaldemokratische) Partei
Der Staat ist hier nichts anderes als der geschäftsführende Ausschuß der herrschenden Klasse.(*2) Er war und ist ausführendes Organ der großen Kapitale, die sich mit Hilfe seiner selbst zu eben diesen Großkapitalien gemacht hatten, Hinter den weltweit bekannten japanischen Markenzeichen Sony, Honda usw. stecken die alten feudalen Clans, die in den als Aktiengesellschaften operierenden Firmen die Majoritäten halten und sie als Familientrusts führen. Die Beibehaltung des Kaisers, der mit den Vorteilen versehen war, einerseits als Symbol der Einheit Japans dienen zu können, andererseits – dies unterstützend – als Gott angesehen zu sein, ist somit nicht weiter verwunderlich. Zur Demokratie wurde dieses Staatswesen nach dem 2. Weltkrieg von den siegreichen Amerikanern gemacht (die übrigens auch den Tenno zu der Erklärung zwangen, er sei gar kein richtiger Gott). Seither existieren in Japan Parteien, aber nur eine gilt als staatsfähig, da in ihr die relevanten Kapitalisten zusammengeschlossen sind – nämlich die LDP. Sie ist ein Beratungsausschuß, in dem sich diese Kapitalisten auf bestimmte staatliche Aktionen einigen, und ein Verteilungsausschuß, der die staatlichen Mittel untereinander aufteilt. Daß die Japaner diese Partei auch mit monotoner Regelmäßigkeit wählen, verdankt sich der simplen Einsicht, daß ohne sie der Staat überhaupt nicht möglich ist, so daß allerhöchstens einmal ein sozialdemokratischer Bürgermeister die Ausnahme macht.
Da staatliches Handeln also unmittelbares Ergebnis der Machtkämpfe der factions in der LDP ist, wundert sich dort drüben auch niemand über die alltägliche Korruption; sie ist nicht als selbstverständliches Übel geduldet, sondern als notwendige geschäftliche Grundlage anerkannt – derjenige setzt sein Interesse im Staat durch, der im richtigen Moment am meisten springen läßt (wozu übrigens auch der Ankauf der geschicktesten Geishas zählt, was diesem eigenartigen Berufsstand seine geheimnisvolle Stellung zwischen gesellschaftlicher Reputation und niedrigstem Trieb beschert).
Ärger gibt es da nur, wenn ausländisches Kapital sich diese Praktiken zunutze macht und gar einheimische Firmen übertrifft (Lockheed).
Keine Sozialstaatsillusion
Sozialstaatsillusionen gibt es in Japan nicht, und zwar aus dem einfachen Grund, daß der Staat nie in den Verdacht gerät, er könnte etwas für seine arbeitenden Bürger unternehmen wollen, was ihrer Arbeitsfähigkeit zugute käme.
Er überläßt die „Sicherung“ der Existenz der Lohnarbeiter ganz der Wirtschaft, mit den schon dargestellten unterschiedlichen Folgen für Stamm- bzw. Zeitarbeiter, zwingt so die Familien, sich als Reproduktionseinheit und wechselseitige Sozialversicherung der Generationen zu bewähren. Das gegenseitige Aufeinanderangewiesensein und die gegenseitige Ausnutzung der Familie erfahren ihre ideologische Überhöhung und Rechtfertigung im Gerede von der „traditionell starken Familienbindung“ der Japaner und in einer Religion, in deren Zentrum der Ahnenkult steht.
Japan ist also alles andere als ein mangelhaft funktionierendes Staatswesen. Solange es sich für die großen Kapitalien im gewünschten Sinne dienstbar macht, sind all die Zeichen seines Nichteingreifens Zeichen für sein glänzendes Funktionieren, und aufgrund seiner Lebensumstände kommt auch kaum ein Japaner auf die Idee, sein Staat würde hier irgendwo versagen. Zusammenbrechende Häuser, fehlende Stromversorgung etc. braucht niemanden zu stören, solange er sich trotzdem zur Arbeit schleppen kann, und daß weite Teile des Landes unerschlossener Urwald sind, dieser Staat also nicht einmal sein eigenes Gebiet ganz kennt, ist für die Selbstmörder nur von Vorteil, die in Städten ohne feste Balken letztlich auf einen Suiziddschungel angewiesen sind.
Durchaus modellhaft
In einer Hinsicht kann sich natürlich auch dieser Staat mit dem Modell Deutschland messen: in seinem Gewaltapparat. Nicht nur, daß sich der Staat seines so drangsalierten Volkes nie ganz sicher sein kann, sondern auch die massiven Auswirkungen einer dergestalt sich selber überlassenen Konkurrenz machen es ihm zur Selbstverständlichkeit, daß er zur Überwachung seiner Bürger und zur ,,kompromißlosen Verbrechensbekämpfung“ nie zu viel Geld in den Polizeiapparat stecken kann.
„Ein lückenloses Netz von Nachbarschaftspolizei überwacht die Gesellschaft ... Japans Polizei steht in dem Ruf die effektivste Schutztruppe der Welt zu sein.“ (Spiegel Nr. 46/77).
In Tokio sind die Polizeiwachen keine 10 Gehminuten weit voneinander entfernt, so daß der Streifengänger grundsätzlich alles erfährt, was sich in seinem Bezirk tut.
„Im Schnitt betreut er 450 Haushalte, spricht in jedem einzelnen mindestens zweimal im Jahr vor“ (ebd., 175),
um die Leute über Familienstand, Beruf, Untermieter, Lebensgewohnheiten und Hobbys zu befragen. Umgekehrt braucht kein Japaner, der seinem Staat einen Dienst tun will (und das ist für die meisten selbstverständlich), nicht weit zu laufen, wenn er etwas Auffälliges bemerkt hat: An der nächsten Ecke steht sein Koban, der ihn kennt und seine Nachricht gern abnimmt. Auf diese Weise kommt die Polizei zu spektakulären Fahndungserfolgen:
„Ein braver Japaner rümpfte die Nase, und lief zur Polizei. »In unserem Land trifft man äußerst selten einen Menschen«, sagte er später, »der einige Tage lang nicht gebadet hat«. Die empfindliche Bürgermoral ermöglichte der Polizei, eine der meistgesuchten Terroristinnen zu verhaften.“ (ebd., 175)
Japanische Konfliktbewältigung
Wenn einmal eine größere Anzahl von Japanern in Konflikt gerät mit ihrem Staat, so gibt sie schon durch die Art der Auseinandersetzung zu erkennen, wie sehr ihr die besondere Form ihres Staates zur Selbstverständlichkeit geworden ist: sie ruft nicht nach Reformen oder Austausch von Staatsmännern, sondern greift zum Knüppel und setzt der staatlichen Gewalt die privatorganisierte entgegen. Hat man sich dann lang genug gegenseitig totgeschlagen – und das ist wörtlich zu nehmen –, dann stellt sich am Ende heraus, daß die Polizei militärisch besser organisiert ist, und man trennt sich mit einem „Nichts für ungut“ – es war halt nichts zu machen. Die besonders Militanten künden entweder vom Ruhm Japans auf ausländischen Flughäfen, gehen in den japanischen Gefängnissen drauf, oder setzen ihre im Kampf erworbenen Fähigkeiten schließlich doch auf traditionell japanische Weise um, woraufhin sich ihnen massenhaft offene Arme auftun:
„Radikalinskis, so kalkulieren die Konzerne, werden aggressivere Verkäufer.“ (II, 23)
Ebensowenig stößt sich irgendjemand daran, daß man sich mit Geld Gewalt kaufen kann, so daß dem Kapital nützliche Formen des Faustrechts, nämlich die Mafia bzw. der ihr angegliederten Schlägertrupps, vom Staat nicht nur geduldet, sondern – aus oben geschilderten Gründen – sich der öffentlichen Belobigung und mancher staatsmännischer Bankettreden sicher sein können.
Rabiat auf dem Weltmarkt
Seine vornehmste Aufgabe hat der japanische Staat darin, die Expansion des japanischen Kapitals auf dem Weltmarkt durchzusetzen, und zwar mit einer Rabiatheit, die dem Umgang mit dem eigenen Ausbeutungsmaterial entspricht. Die simple Eroberungstaktik vor dem 2. Weltkrieg – man vereinnahmte die Länder, die als Absatzmarkt in der „großasiatischen Wohlstandssphäre“ nützlich erschienen bzw. dem äußerst rohstoffarmen Japan die Ressourcen zur Verfügung stellen konnten – ist mit der Niederlage durch die USA gezwungenermaßen mehr friedlichen Mitteln gewichen.
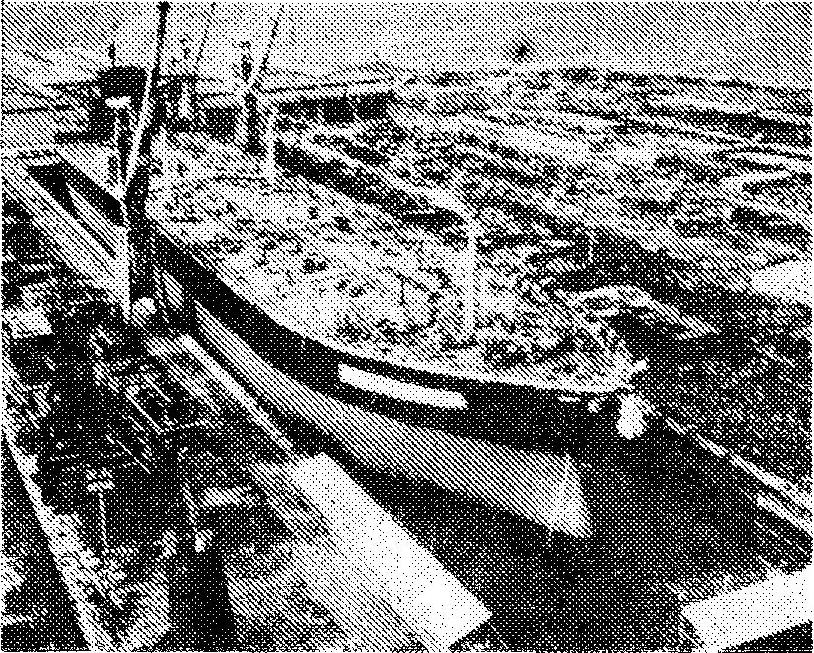 |
Dies stellte sich jedoch durchaus als Vorteil heraus: nicht nur ersparte der Staat sich die gesamten Rüstungskosten (ein Verbot der Amerikaner zwang ihn zu dieser Maßnahme), sondern er konnte aufgrund seines friedlichen Charakters voll und ganz auf den Schutz eben der USA bauen, da diese an einer starken Freiheitsmacht in dieser Weltgegend interessiert waren, sozusagen als ,,Marshall-Plan-Hilfe“ ihre schützende Hand über die wirtschaftliche Expansion Japans hielten. So erklärt sich der außergewöhnliche Umstand, daß die Japaner ihre Grenzen gegen den Import abschotten konnten und andererseits mit ihren Dumpingpreisen auf fremden Märkten auf keinen nennenswerten Widerstand stießen. |
Die rücksichtslose Expansion des japanischen Kapitals ist zwar nahtlos durch den Staat vermittelt, wie der Herr damaliger Staatssekretär Klaus von Dohnany bewundernd feststellt –
„Außenpolitik und Innenpolitik, Wachstumspolitik, Technologiepolitik, Wettbewerbspolitik und Handelspolitik, werden vom politischen Management Japans lückenlos aufeinander abgestimmt.“ (V, 90)
erklärt sich jedoch weder mit jenem noch mit irgendeiner ominösen Mentalität. Der Grund ist wie immer ein ökonomischer.
Japanische Besonderheiten …
Weil das japanische Kapital vom Adel aus dem Boden gestampft wurde, entstanden hier nicht die verschiedenen produktiven Abteilungen als Resultat der Bedürfnisse des sich ausweitenden Marktes. Nur einige wenige Konzerne, die die gesamte Ökonomie in den Dienst ihrer Akkumulation zwingen und beherrschen, verfügen über eine Produktivität, die auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig ist und hauptsächlich für diesen produziert. Oder anders: In Japan bildete sich nie ein normaler kapitalistischer Binnenmarkt heraus, gewisse Teile der Produktion werden nur formell kapitalistisch betrieben. Das bedeutet, daß die große Masse der Zuliefererbetriebe für die wenigen großen Kapitalien auf weltmarktmäßig äußerst niedrigem Niveau produzieren. Sie sind überhaupt nur überlebensfähig dadurch, daß sie als Familienbetriebe und unter schonungslosester Ausbeutung der Familien- wie Zeitarbeiter-Arbeitskraft geführt werden. Diese
„duale Struktur der japanischen Volkswirtschaft, d.h. das Nebeneinander von modernen Großunternehmen und einer großen Zahl vorwiegend traditionell geführter Mittel- und Kleinbetriebe“ (VI, 16)
verdankt sich dem Diktat der Großbetriebe, die auf billigsten Einkauf bei den ,,Klein- und Mittelbetrieben“ angewiesen sind und ihn aufgrund ihrer ökonomischen Macht auch durchsetzen. Dies führt dazu, daß ein Teil des Kapitals den anderen zwingt, seine Produkte beständig unter Wert zu verkaufen, daß ersterer Teil dem anderen also auch einen wesentlichen Teil des Mehrwerts, wenn nicht den ganzen, streitig macht. Daß diese der feudalen Produktionsweise nicht entwachsenen Betriebe überhaupt überlebensfähig sind, rührt von daher, daß der aus seinem Betrieb entlassene Stammarbeiter sich nicht anders ernähren kann, als indem er seinen Familienverband und seine Abfindung (30 - 50 Monatsgehälter) dafür einspannt, die Frist bis zum Tod ein bißchen zu verlängern – und koste es härteste Anstrengung. Wenn also „eine weitere sehr beträchtliche Anzahl von Arbeitern mittlere oder kleine Unternehmer oder Heimarbeiter werden“ (VII, 231), |
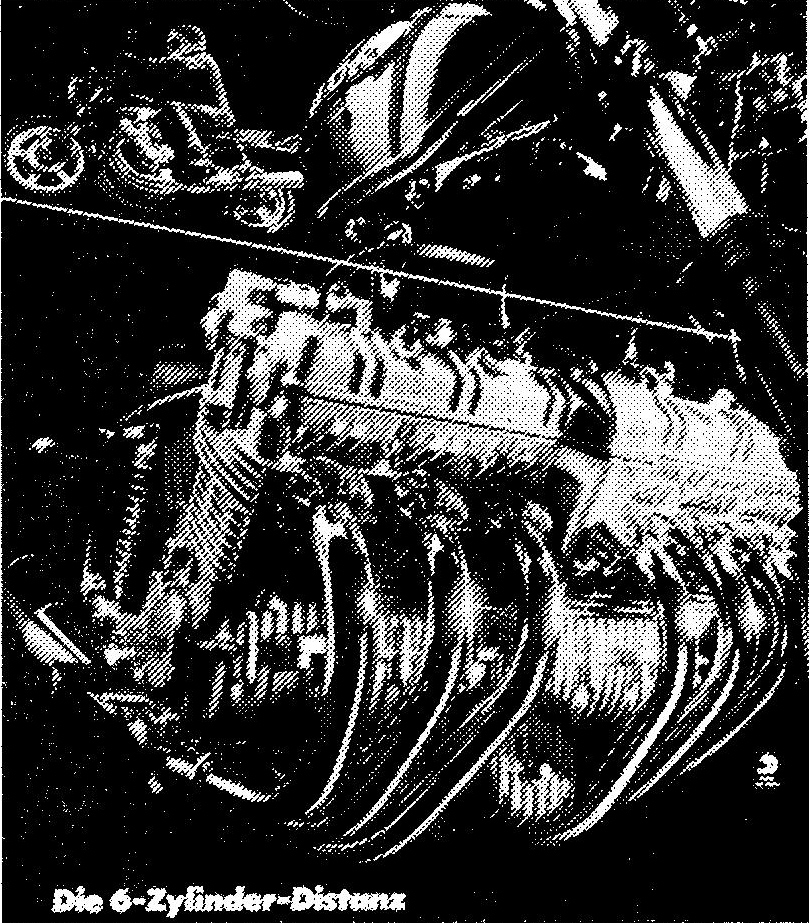 |
dann sorgen diese Arbeiter für die Aufrechterhaltung eines genialen Kreislaufsystems, in dem den großen Kapitalien die notwendigen Produkte und die ausbezahlte Abfindung mit eherner Gesetzmäßigkeit zu- bzw. zurückfließen. Wirkungen dieser eigenartigen Zusammensetzung des japanischen Kapitals sind:
1. Die Produktionsgüterabteilung ist schwach ausgebildet, die kapitalistische Expansion beruht auf der Konsumgüterindustrie.
2. Dem läuft unmittelbar zuwider, daß die zahlungskräftige Nachfrage aus den genannten Gründen noch mehr beschränkt ist, als in einem „normalen“ kapitalistischen Land, was sich
3. darin zusammenfaßt, daß sich der Binnenmarkt in Japan immer nur bruchstückhaft entwickelte und entwickelt.
Die überraschende Bestätigung der Stamokap-Theorie – nämlich daß das allzuenge Zusammenwirken von Staat und Kapital, wogegen hiesige Verhältnisse so positiv abstechen, nur zum Schaden des Staats und des nationalen Wachstums sein kann – durch dieses recht außergewöhnliche Land, ist dem japanischen Staatskapitalismus überhaupt kein Problem, ist ihm doch die Besonderheit seiner inländischen Produktionsstruktur nur günstige Voraussetzung dafür, mit niedrigen Weltmarktpreisen in fremden Ländern einzubrechen.(*3)
… und imperialistische Gemeinsamkeiten
Es gilt jedoch auch die Umkehrung: aufgrund dieser Struktur ist er gezwungen, seine nationale Akkumulation unter sofortigem Einbezug fremder Märkte voranzutreiben – was manchen westlichen Ideologen zu dem Schluß drängt, daß man es in unseren Breiten mit einem viel freundlicheren Kapital zu tun habe, weist dieses doch den Vorzug auf, sich auf Basis eines entwickelten Binnenmarktes die Welt anzueignen. Was der Ideolog darüber bereitwillig vergißt, ist, daß natürlich sein Kapital genauso gezwungen ist, sich imperialistisch zu betätigen – ein, da mit dem willigen Menschenmaterial vollzogen, äußerst angenehmer Zwang. Im Resultat löst sich der laufend angestellte Vergleich also dahin auf, daß die Japaner ihre Weltmarktexpansion früher anfangen.(*4)
Und infolge der Reife, die der Kapitalismus inzwischen weltweit erreicht hat, ist selbst dieser Unterschied praktisch beseitigt.(*5) Woraus nur ein weiteres Mal der düstere Schluß folgt, daß die kommenden, verschärften imperialistischen Auseinandersetzungen ganz normal auch in dieser Weltecke stattfinden werden.(*6)
Nachweis der Zitate: (I) Hans-Bernd Giesler: Die Wirtschaft Japans. Düsseldorf, Wien 1971 (II) Japan. Sonderteil zu Stern Nr. 28, 30.6. 1977 (III) Günther Haasch: Japan. Eine politische Landeskunde. Berlin 1973 (FU) (IV) Katsumi Yakabe: Labour Relations in Japan. (Ministry of Foreign Affairs, Japan 1977) (V) Kazuo Okochi: Labour in Modern Japan. Tokio 1958 (VI) Klichi Ichtara, Susumo Takeyama: Die japanische Unternehmung – Strukturverwandlungen einer wachsenden Wirtschaft. Opladen 1977 (VII) Kazuo Okochi (Hrsg.): Wirtschaft Japans – Wachstum und Strukturwandel. Düsseldorf 1973 |
_________________________
(*1) Prognosen und „Zukunftsforschung“ sind eben ein unwissenschaftlicher Schmarrn, worauf angesichts ihrer ungebrochenen Popularität nie oft genug hingewiesen werden kann!!
(*2) Das ist ein Marx zugeschriebenes Zitat, das sich jedoch in seinen Schriften nicht findet. Vermutlich eine schöpferische Weiterentwicklung des Satzes aus dem „Manifest“: „Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuß, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet.“
(*3) An diesem Absatz läßt sich erkennen, daß die Staatstheorie der MG damals noch nicht ganz ausgereift war. Der Erfolg des japanischen Staats und Kapitals widerlegt doch gerade diese Theorie.
(*4) Das Umgekehrte ist der Fall. Japan trat auf dem fertigen Weltmarkt später auf als seine kapitalistischen Konkurrenten und muß daher sein Menschenmaterial anders zurichten, um bei geringerer Ausbeutungsrate dennoch mit ihnen mithalten zu können. „Früher“ unterstellt eine Art lineares Entwicklungsmodell, das alle kapitalistischen Staaten zu durchlaufen hätten. Dergleichen läßt aber die imperialistische Konkurrenz nicht zu.
(*5) Gemeint ist offenbar, daß der fehlende oder gering entwickelte Binnenmarkt sich nicht als Hindernis der Kapitalakkumulation erweist, solange sich das japanische Kapital auf dem Weltmarkt bewährt.
(*6) Damit soll offenbar angedeutet werden, daß Japan zwar als Juniorpartner der USA im Kalten Krieg seine Chance zum Aufbau einer nationalen Kapitalakkumulation erhalten hat, sich aber einmal zu einem vollwertigen Konkurrenten seiner „Schutzmacht“ entwickeln wird.
aus: MSZ 29 – Mai 1979
Fortsetzungen: „Japan – Besonderheiten einer Handelsnation“ in MSZ 1/1981, „USA und Japan – Eine Lektion in Sachen Gerechtigkeit im Welthandel“ in MSZ 3/1991