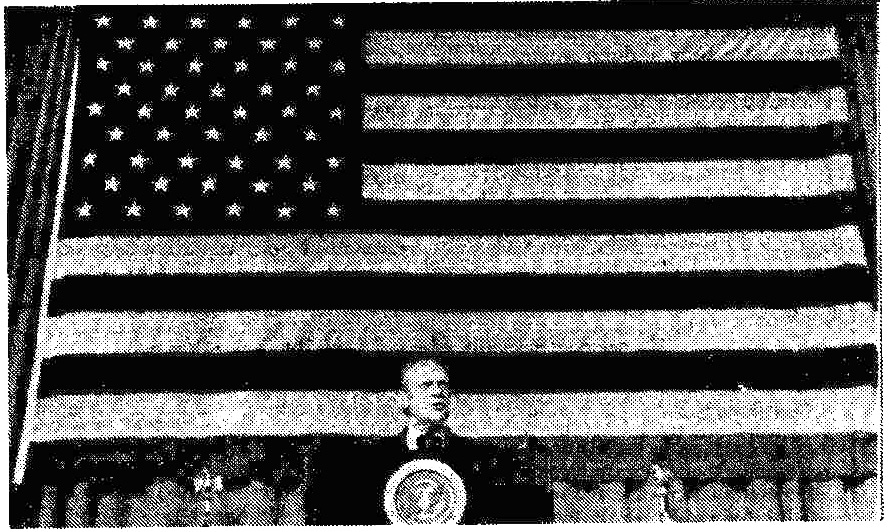
Die Annehmlichkeiten der größten Demokratie und ihre Brauchbarkeit für Ausbeutung und Krieg
Mit großem Aufwand feiern die Amerikaner Abschied von 200 Jahren ruhmreicher Vergangenheit. Nicht sonnenbeschienene Zuversicht wird analysiert, kritisiert, bombastisch werden vergangene Großtaten ausgeputzt und das wahre, gesunde Amerika wird beschworen. In einem Wort, die Amerikaner sind unzufrieden, und sei es auch nur in Form des dumpfen Unbehagens.
„Wir wissen, daß etwas sehr verkehrt ist mit unserem Land, aber wir wissen nicht, was.“ (People's Bicentennial Commission, die Gegen-Feierkommission)
Die kritischen Geister machen sich auf die Suche nach Gründen und kommen auf den Vietnam-Krieg, die Wirtschaftskrise, die Umweltverschmutzung, die politische Korruption, die Kriminalität und vieles anderes, was sie unterschiedslos in einen Topf werfen und damit zu erkennen geben, daß es ihnen nicht auf Gründe, sondern auf die Aufzählung von störenden Momenten ankommt. Auch der unkritische Kopf, der ohne viel Worte treu zu seinem Amerika hält, gibt zu, daß etwas faul ist – aber das liegt weniger an Amerika, als an denen, die ständig rumnörgeln und an denen, die mal wieder Schwierigkeiten machen: den Gooks, den Japs, den Krauts, die Reds nicht zu vergessen. Und einfacher Realist, der er ist, weist er die Selbstbeschimpfungs- und Enthüllungsmanie mit Entschlossenheit oder auch nur mit einem Achselzucken zurück: das hat es alles schon gegeben, so schlimm ist das jetzt auch nicht, wenn nur etwas unternommen wird ... Damit hat er recht: gegeben hat es das immer schon, es gehört untrennbar zur amerikanischen Geschichte; und waren frühere Kriege nicht noch grausamer, gab es nicht ständig und viel härtere Wirtschaftskrisen, war die Zerstörung der Natur nicht schon immer vorhanden, die Korruption nicht noch größer, das Verbrechen nicht noch mächtiger?
Wenn der unkritische Kopf sich naiv zu den amerikanischen Ungeheuerlichkeiten stellt, so sagt er ironischerweise auch, daß diese nicht mehr so recht funktionieren, und zwar hinsichtlich ihres Auftrages, Amerikas Größe und Weltherrschaft zu sichern: er sagt es, wenn er auf die restliche Welt schimpft, aber auch, wenn er die früheren Errungenschaften bejubelt, sich also mit der Vergangenheit trösten muß, und vollends offenbart er seine Not, wenn er Dingen wie Kaugummi, Blue Jeans und Blitzableiter als Symbolen weltweiter amerikanischer Zivilisierung Denkmäler setzt.
Die Sorge um amerikanische Volkswirtschaft und Demokratie im Jubeljahr 1976 in ihren verschiedenen Varianten drückt also aus, daß sich in Amerika eigentlich nichts verändert hat – und daß doch alles anders ist als früher. Zugleich sagen die Bürger in ihrem Beschwatzen, Bejammern, Bekritteln und Verherrlichen des Heutigen, daß sie keineswegs gewillt sind, an Amerika irgendetwas zu ändern.
Sie wenden sich vielmehr den Politikern zu und machen sich verzweifelt auf die Suche nach einem neuen, dem besten Mann an der Spitze des Staates. Fangen in anderen Ländern die Leute, wenn sie so sehr Zweifel an ihrer eigenen Gesellschaft befallen wie die Amerikaner, an, nach einem neuen, besseren Staat zu fragen, so haben die Amerikaner nichts grundsätzliches an ihrem Staat auszusetzen, sondern wollen nur einen anderen Staatsmann.
Entsprechend sehen auch die amerikanischen Parteien aus: Sie haben keine unterschiedlichen Weltanschauungen, sie sind völlig identisch miteinander. Sie sind nur dafür da, die verschiedenen Interessen dergestalt in sich zusammenzuschließen, daß sich möglichst viele auf einen chancenreichen Bewerber einigen. Die komplizierten Vorwahl- und Wahlmännersysteme dienen diesem Zweck:
„Wir müssen uns ganz offenkundig besser verkaufen.“ (Gerald Ford nach einigen Niederlagen in den „Primaries“)
Damit ist auch erklärt, warum die unterschiedlichsten Typen ihren Platz in ein und der selben Partei haben und jede Partei ihre Liberalen, Konservativen und Faschisten im gemeinsamen Zweck vereint. Dienen diese doch nur dem Herausfinden und der Unterstützung von Kandidaten und die harten Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Interessengruppen haben nur den Zweck, die friedliche Koexistenz aller Interessen zu demonstrieren, den Amerikaner davon zu überzeugen, daß der vorgeschlagene Kandidat keinesfalls etwas anderes als amerikanische Politik zu machen gedenkt:
„Ich will eine Regierung, die so aufrichtig, so ehrlich, so wahrheitsliebend, so fair, so voller Mitgefühl und so voller Liebe ist, wie unsere Menschen sind.“
Und Jimmy Carter sagt gleich dazu, daß keine weltlichen Gedanken seine Regierung leiten sollen, sondern daß der Staat über allem steht, ohne deswegen alles zu beherrschen:
„Ich bete zu Gott, daß ich das Richtige tue.“
Womit er den Leuten außerdem recht gegeben hat in ihren Zweifeln, als auch versichert, daß sich alles zum Besseren wenden werde allein dadurch, das Jimmy Carter ein guter Mensch ist, was freilich verborgen geblieben wäre, hätte ihm Gott nicht seine Talente mit genügend peanuts gelohnt.
„Dem Staat zur Last zu fallen, gilt als unanständig.“ (Stern)
Wenden die Amerikaner sich in diesen schweren Zeiten an den Staat, dann nicht weil sie etwas wollen, was selbstverständlich zur amerikanischen Lebensweisheit gehört und (gerade in der Differenz zum hierzulande gewohnten) auf die zentrale Besonderheit dieses Landes verweist: sie wollen, daß der Staat sich aus dem Leben der Bürger heraushält, und er tut es, soweit möglich.
„Für seinen eigenen Regierungsstil beruft er sich auf ein Wort von Thomas Jefferson, dem Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, wonach »der am besten regiert, der am wenigsten regiert«. Dahinter steht die Idee (?), daß die Regierung möglichst wenig in die Freiheiten der Bürger eingreifen soll“ (Bericht der SZ über Jerry Brown)
Sie reagieren auf die Erschwerung ihrer Lebensumstände nicht mit dem Ruf nach Unterstützung durch den Staat, damit er den Interessenausgleich mehr zu ihrem Vorteil regele, sondern sie wollen den Interessenausgleich noch ungezügelter unter sich austragen können , für die Parteien hat dies seine politische Entsprechung, und lasten die Schuld am Nichtfunktionieren ihrer Konkurrenz untereinander, die Beeinträchtigung amerikanischer Größe und Weltherrschaft, dem zu häufigen Eingriff des Staates an. Sie wollen die Resultate der Konkurrenz unverfälscht gelten lassen und glauben, dadurch ihre Wohlfahrt maximieren zu wie auch durch diese scheinbare Wiederherstellung der einmaligen amerikanischen Lebensqualität nationales Wohl und Einfluß auf die Welt fördern zu können. Das heißt nichts anderes, als daß sie willens sind, die Konkurrenz untereinander zu verschärfen und die dabei ausgeteilten erlittenen Schläge als Inbegriff der Menschenwürde anzusehen.
| „Manchmal kommt mir in den Sinn, nach Amerika zu segeln, nach dem großen Freiheitsstall, der bewohnt von Gleichheitsflegeln.“ (Heinrich Heine) |
Immer noch sind die Bostoner Bürger, die Vorkämpfer der Nation, diesmal im Kampf gegen das „Busing“: Die Auswüchse der vergangenen Jahre, nämlich Leuten, die einfach nicht in der Lage waren, in der Konkurrenz ihren nützlichen Beitrag zu leisten, von Staats wegen Starthilfe zu geben, müssen beseitigt werden; konnte früher noch der Gedanke angeführt werden, man müsse den Schwarzen die Einstiegschancen gewähren und die Konkurrenz durchaus zu ihrem eigenen teil um ein farbiges Element bereichern, so stellen in den wirtschaftlich schweren Zeiten die weißen Mitbürger nur noch fest, daß die schwarzen Mitbürger es nicht besser verdienen, daß der Staat ihnen einen ungerechtfertigten Vorteil im Leistungsausgleich verschafft hat, und damit sowohl dem ordentlichen weißen Leistungsmenschen als auch der Volkswirtschaft überhaupt schadet.
Darin kommt nicht nur der radikale Wettbewerbsgedanke zum Vorschein, sondern gleich noch die institutionelle Verlaufsform, die er sich im Staatsapparat gibt, nämlich das föderalistische Prinzip. Daß die Zentralgewalt, das „Busing“ mit Gewalt gegen die lokalen Instanzen durchsetzt, zeigt, daß es die Notwendigkeit von Staatseingriffen gibt, und auch den institutionalisierte Widerstand dagegen: die Bundesstaaten wehren sich systematisch gegen die Übergriffsrechte der Zentralgewalt und sind ihr zugleich unterstellt.
Seine Entsprechung hat dieses feinausgebildete System von übergreifender Macht und regionaler Eigenwilligkeit in dem lokalpatriotischen Denken der Bürger. Auch von ihren regionalen Instanzen erwarten sie weniger, daß diese für die allgemeinen Bedingungen der Konkurrenz in dem jeweiligen Bezirk sich stark machen, sondern sie wollen einen unmittelbaren materiellen Rückfluß für sich selber sehen – mißtrauisch überwachen sie die Handlungen ihrer gewählten Vertreter, könnten jene doch auch den Faulen und Schwachen zugute kommen, also Abzug am eigenen Vorteil bewirken. Die enge Verbindung der lokalen Administration mit der jeweils stärksten Interessengruppe („Diese Stadt gehört...“ erfährt der Privatdetektiv, kaum daß er seinen ersten Whisky trinkt, und er weiß, auf wen er achten muß) ist also gesellschaftlich anerkannte Korruption und nicht mangelhaftes Demokratieverständnis, sondern im Gegenteil der durchgesetzte demokratische Leistungsgedanke reinsten Wassers.
Seine widerliche Ergänzung hat dieses Prinzip in der caritativen Fürsorge der Amerikaner für diejenigen, die sie zugrunde richten. Auch hier überlassen sie es nicht dem Staat, die Gefährdeten zur Einsicht und Voraussicht zu zwingen, d. h., sie zur Sozialversicherung u. ä. zu verpflichten, sondern reiben den Gescheiterten ihre Dummheit und Erfolglosigkeit noch eigens unter die Nase: sie reichen eine mildtätige Gabe – zum Sterben zuviel – und dies natürlich mit dem Alptraumgedanken im schlauen Hinterkopf, daß auch ihnen einmal ähnliches widerfahren könnte. Statt darüber nachzudenken, verplanen sie einen Teil ihres Budgets für Alkohol und Sammelbüchse und gelten solange aus gute Bürger, wie der übermäßige Zuspruch zum Alkohol nicht zum Anspruch auf die Sammelbüchse wird.
Nun ist damit natürlich noch nicht geklärt, warum die Amerikaner sich in so gigantisch-groteske Wahlkämpfe stürzen, wenn es nur um einen möglichst untätigen Präsidenten gehen soll und dies auch noch im Schicksalsjahr 1976. Die Antwort ist einfach: es kommt ihnen doch sehr auf den Präsidenten an.
Die diktatorischen Vollmachten sind ihm dafür verliehen, daß er den riesigen amerikanischen Gewaltapparat möglichst effizient auf der ganzen Welt einsetzen kann und somit Amerikas Wohl sichere. Der gewöhnliche Verstand geht dabei davon aus, daß es am Präsidenten liege, wenn Amerikas Einsatz für Frieden, Sicherheit und Demokratie in bedrohten Ländern nicht so recht funktioniert, und kommt deswegen auf die Idee, daß die Präsidenten Johnson und Nixon schlechte Regenten waren, und die Eigenschaften, die sie zu Präsidenten machten, entpuppten sich als menschliche Abgründe: selbst bei Kennedy entdeckt man – je mehr seine Initiative für den Vietnam-Krieg bewußt wird – zunehmend Damenunterwäsche in den Schubladen, was man doch wohl bei den meisten Politikern gekonnt hätte (immerhin ist ihm aber noch Mannbarkeit zugesprochen). So haben die Republikaner unlängst 75 000 Dollar bereitgestellt, um auch J. Carter ein Dessous in die Lade zu legen. Konsequent denn auch die Vorstellung, Watergate habe die außenpolitische Handlungsfähigkeit der USA beschränkt und die Russen gestärkt. Klappt es aber mit dem Geld, CIA und Militäreinsatz für die Freiheit der Welt und werden Klagen der Befreiten laut, so kümmert das den Amerikaner wenig und er stellt an anderen Ländern deren demokratische Unreife fest.
Der arme und unverstandene Henry Kissinger kann in solch aufgewühlten Zeiten mit Sprüchen folgender Art natürlich nur als blanker Defätist erscheinen, obwohl er handfeste Drohungen ausspricht:
,,Durch Zusammenarbeit und Solidarität der industriellen Demokratien der Welt können wir mit anderen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft gemeinsame Programme ausarbeiten, mit denen wir den ständig schwieriger werdenden Herausforderungen entgegentreten können und wir in unseren gemeinsamen Bemühungen fortfahren, die internationalen Spannungen zu verringern.“
Und jeder Präsidentschaftskandidat versichert angesichts der 200jährigen Vergangenheit seine Entschlossenheit, die Enthaltsamkeit in Amerika mit der größten Entschiedenheit gegenüber der Welt zu paaren. Das hat seinen Grund.
„The Business of America is Business“: Das Land des unbegrenzten Kapitalismus
,,Money is like an arm or leg – use it or lose it,“ (Henry Ford I.)
Der Streit um den Präsidenten, daß er stark sein muß, um Amerikas Stellung in der Welt zu wahren, zeigt, daß die Größe der USA. ihre nationale Volkswirtschaft angewiesen ist auf den bedingungslos nach außen hin agierenden Staat, worin die Identität mit allen kapitalistischen Staaten liegt und der Unterschied nur im Ausmaß der Außenpolitik (da allerdings erheblich). Wenn es aber auf die Person ankommt, die nur auf diesem Gebiet die größte Machtfülle haben muß und darf, dann handelt diese Person eben nur in Verlängerung der vorausgesetzten gesellschaftlichen Verhältnisse, die zu ihrer Sicherung des außenpolitischen Einsatzes bedürfen. Entsteht nun das große Jammern über die angekratzte Handlungsfähigkeit des amerikanischen Staates, dann, weil sie Beschaffenheit der amerikanischen Gesellschaft sich gerade in Folge der außenpolitischen Beschränkung in ihrer besonderen Widersprüchlichkeit geltend macht.
„Der Zusammenhang zwischen politischer Geschichte und Wirtschaftsgeschichte ist im Falle der USA weitaus offensichtlicher als bei anderen Ländern. Schon die Entstehung der USA war im Grunde das Resultat wirtschaftlicher Ereignisse.“ (Kleiner Wirtschaftsspiegel der Sparkassen, Mai 1976)
Wie die Welt für die Segnungen der freien Konkurrenz zu erobern ist, ist dem Amerikaner in Fleisch und Blut dadurch, daß er sich selbst nur schuf im gewalttätigen Niederwerfen der in Amerika ansässigen Nichtamerikaner: die Konstituierung Amerikas ist der Imperialismus im eigenen Land.
Im Mittelpunkt der amerikanischen Verfassung steht der ,,pursuit of happiness“ von Thomas Jefferson nicht zufällig anstelle des Begriffs „Eigentum“ eingesetzt, womit die Verpflichtung der Individuen, auf Gedeih und Verderb ihr Glück zu schmieden, und das Prinzip der freien Konkurrenz als der amerikanische Staatszweck deklariert ist. Den einströmenden Einwanderern, nachdem sie ihr Eintrittsgeld in die Freiheit abgedient hatten, wurde der gesamte Kontinent zur Verfügung gestellt mit der ehrenvollen Auflage, nur auf sich selbst gestellt, die amerikanische Nation zu schaffen.
Der Inbegriff der Demokratie: ,,Checks and Balances“ Die Amerikaner haben das demokratische Prinzip der Gewaltenteilung dahingehend perfektioniert, daß in ihrem Parlament, dem Kongress, die Legislative selbst noch einmal in zwei sich wechselseitig kontrollierende Körperschaften zerfällt: im Repräsentantenhaus sitzen die direkten Interessenvertreter aus den Wahlkreisen, in ihm soll also das Volk repräsentiert sein, im Senat hingegen hat jeder Bundesstaat ungeachtet seiner Größe zwei Vertreter. Anders als in den europäischen Demokratien, wo das Parlament die Regierung kontrolliert, hat in den USA der Präsident die Möglichkeit, diejenigen, die ihn beaufsichtigen, selbst wieder zu zügeln: das presidential veto kann jedes Gesetz blockieren, zumindest für eine geraume Zeit. In der Wahl ihrer Interessenvertreter (Repräsentanten) versuchen die Amerikaner ihres getrennt davon gewählten Präsidenten dadurch habhaft zu werden, daß sie einen Mann nach Washington schicken, der über großen Einfluß verfügt. Dazu muß er Macht und Vermögen aufweisen, Beziehungen durch Freundschaften mit den richtigen Leuten, um die Interessen der jeweiligen Constituency mit dem nötigen Nachdruck zu versehen. Hat dies einerseits zur Folge, daß das House eine einzige Versammlung von Lobbyisten ist (klar, daß z. B. Detroit, eine Stadt, die von General Motors lebt, einen GM-Mann entsendet), andererseits, daß es auf die politische Ausrichtung des Mannes nicht ankommt (schlagend zeigt dies der Umstand, daß kein Amerikaner etwas dabei findet, einen republikanischen Präsidenten zu wählen und zur gleichen Zeit einen Demokraten zum Repräsentanten), ebenso wenig wie auf die moralische Integrität des Abgeordneten, solange er nur über Einfluß verfügt (so ist es zu erklären, daß Harlem 20 Jahre lang einen korrupten Neger namens Powell wählte, dessen gerichtsnotorische Veruntreuung öffentlicher Gelder seinen Fans als Beweis für seine Geschicklichkeit im Umgang mit der Administration galt, und daß die Wähler von Ohio an ihrem in eine prickelnde Lotterbettgeschichte verwickelten Congressman festhalten, weil sie in ihren puritanischen Zeitungen lesen können, daß Mr. Hays sehr einflußreich ist). Während die Bürger sich so einerseits über den Repräsentanten ihres Staates bedienen, statt einer den Interessen übergeordneten Instanz, betrachten sie ihn doch als Mittel, Sonderinteressen durchzusetzen, verlangen sie andererseits von den Senatoren das Festhalten an den übergeordneten Interessen des Bundesstaates gegen einzelne Interessengruppen, die sich auf nationaler Ebene zusammengeschlossen haben und erkennen durch dieses exotische System an, daß auch in Amerika der Nutzen des Staats für die Bürger sich nur über deren Beschränkung herstellt. Der Präsident, der diesem Parlament seine Gesetze vorlegt, erhält sie dann vom Interessenkonflikt der Repräsentanten bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt zurück und kann sie nun entweder akzeptieren oder sie mit seinem Veto verhindern, sofern ihm nicht der Senat dies bereits abgenommen hat, in dem sich stets wechselnde Mehrheitskoalitionen finden, um Reformen abzublocken, die für den Süden, die Industriestaaten der East Coast oder die Ranch-and-Farmlands des Mittelwestens unvorteilhaft sind. Die Zusammensetzung des Kongresses blockiert Reformen, was aber nicht heißt, daß der Staat seiner Hauptaufgabe, der Erhaltung der freien Konkurrenz, nicht nachkommt, allerdings bis weilen in einem Ausmaß, das deren Grundlagen zu zerstören droht: So erklärte das berühmte 14. Amendment Unternehmen zu natürlichen Personen, wodurch ein Streik z. B. als Körperverletzung bzw. Totschlag kriminalisiert werden kann und das Eingreifen der Staatsgewalt im Arbeitskampf legalisiert wird. Gegen die Auswirkungen solcher unmittelbarer Instrumentalisierung des Staates durch das Kapital kann sich dann auch einmal ein Präsident mit einem Programm gegen die Armut durchsetzen, wenn die Armen allzu unruhig werden und ganze Stadtviertel in Schutt und Asche legen. Nach außen hingegen konnte sich der Präsident auf die volle Unterstützung beider Häuser des Kongresses verlassen, als der US-Staat seinem Kapital den Sprung über die Landesgrenzen und die Unterwerfung des ganzen Erdballs unter seine Verwertung mehr oder weniger reibungslos garantierte. Das Vetorecht des Senats in außenpolitischen Angelegenheiten (welches wiederum der Präsident unterlaufen kann, so z. B. Johnson, der mit der „Tonking-Affäre“ ohne Kriegserklärung einen Krieg durchsetzte) kam fast nie zur Anwendung, solange Zufriedenheit über die Stärke der USA bestand. Seit dies anders geworden ist, kommt es immer wieder vor, daß der Senat sich in die Außenpolitik des Präsidenten einmischt, das Haus die Mittel zum Kriegführen verweigert. Während früher die Präsidenten mühelos ihre außenpolitischen Raubzüge als Gesetz durch's Parlament brachten, das sich deren Notwendigkeit für das Wohl der Nation (worin dies bestand, wußten diese Repräsentanten und Senatoren nur zu gut, leben sie doch davon) nicht verschließen konnte, weil sie erfolgreich waren, mißtraut der Kongreß spätestens seit dem Vietnam-Krieg der Nützlichkeit alter Formen der Durchsetzung amerikanischer Interessen. Daß sich in den letzten Jahren immer wieder gemeinsame Fronten beider Kammern des Kongresses gegen den Präsidenten gebildet haben, gegen diesen Außenpolitik gemacht wurde und auch innenpolitische Gesetze gegen ihn durchgeboxt wurden, ist ein Zeichen der Krise, mit der die USA ihr 200jähriges Jubiläum begehen. Daß dies nicht der mangelnden Ehrlichkeit der Führung geschuldet ist, wie Jimmy Carter behauptet, oder gar mangelndem Gottvertrauen, erklärt dieser Artikel. |
Dabei hatten die Amerikaner andere Voraussetzungen als die Europäer, denn sie mußten kein festgefügtes feudales Staatswesen über den Haufen werfen und sie fanden auch keine gesellschaftliche Hierarchie vor, die den egalitären Forderungen des Kapitalismus – das Ansehen einer Person ergibt sich aus ihren geschäftlichen Leistungen als wahrem Ausdruck der Menschennatur – Widerstand geleistet hätte: daß der Feudalismus den Kapitalismus gebiert, tritt in den USA gerade aufgrund der nur losen kolonialen Bindung ungehindert hervor. In Amerika herrscht die ,,reine Bourgeoisie“, sagte John Stuart Mill begeistert. Stießen die vordringenden Siedler auf Territorien, die der Hoheitsgewalt anderer Nationen unterstanden, so kaufte der amerikanische Staat diese Gebiete („Louisiana Purchase“, Alaska) oder erzwang durch militärisches Eingreifen deren Abtretung, so die ,,Spanish Cession“ 1819, die Annektion Texas und Oregons, die Zession Kaliforniens von Mexiko 1848.
Das Beispiel Texas zeigt, daß der Staat jedoch nur eingriff, wenn die Bürger den Boden schon bereitet hatten und der Schritt zur endgültigen Zivilisierung von den Siedlern nicht mehr ohne allzuviele Blutopfer getan werden konnte: die Texaner hatten sich von Mexiko losgeschlagen und in der Schlacht von Alamo eindringlich demonstriert, daß sie sich das Land teuer genug beschafft hatten und der Staat nur dafür sorgen mußte, daß von jetzt an nur noch mexikanisches Blut zu vergießen war. Nicht umsonst verkörpert der Texaner, dessen Nationalismus darin besteht, zu demonstrieren, wie weit man es aus eigenen Kräften bringen kann, die Spezies des Amerikaners.
,,Pursuit of happiness“ heißt also, daß es nur gerecht ist, wenn der Beste und Stärkste gewinnt. Wo sich einer dagegenstellte, war ihre Gewalt zur Hand. Ein Prinzip, das seit John Fords ,,Judge Haller's Saloon and Court“ in ,,The Iron Horse“ unzählige Westernfilme vorführen: zwischen kontroversen Ansprüchen entschied dieser Saloonbesitzer und selbsternannte Richter auf der Basis der Konsultation einen zerfledderten Sammlung von Gerichtsurteilen derart, daß der Streit der beiden Parteien darüber, welches Urteil zutreffen solle, als allgemeine Schlägerei ausgetragen wurde: die Gruppe, die die Übermacht hat, ist im Recht. Demonstriert das Heranziehen von Rechtsbüchern das Festhalten am Recht, so umgekehrt die Entscheidung durch die Gewalt des einzelnen dessen Undurchführbarkeit. Daß die Bürger so auf ihre Weise für Recht sorgen, spricht den Widerspruch aus, daß die Rechtsordnung gelten solle, sie aber nur durch das Faustrecht errichtet und erhalten werden kann.
Daß dies keine historische und mittlerweile überwundene Besonderheit ist, zeigt sich an der Tatsache, daß Sheriff und Staatsanwalt gewählt werden. Schließlich an der durchaus handgreiflichen Rechtswahrung der amerikanischen Bürger, die ganz selbstverständlich ein Gewehr im Hause haben – nicht zum Jagen.
Daß die Indianer dran glauben mußten, ist selbstverständlich, wußten diese doch nicht, worauf es in der Welt ankommt, denn alle „Gemeinschaften wie Einzelindividuen werden durch den Wunsch angestachelt, ihre Lebensbedingungen zu verbessern.“ Für den amerikanischen Kriegsminister gab es keinen Zweifel, was von den Indianern zu halten war: sie lebten in den Tag hinein, ohne nach Reichtum, Macht „oder irgend etwas anderem“ zu streben, ,,dessen Besitz geeignet scheint, die Tagträume unserer Einbildungskraft zu erfüllen“ (Lewis Cass). Solches Streben aber ,,garantiert den Fortschritt der Gesellschaft“, womit klar ist, daß die Indianer dem Fortschritt im Wege standen.
Der vom Staat geführte Vernichtungskrieg gegen die Indianer setzte das durch, was die Eigeninitiative der Pioniere nicht erbrachte, und wenn die Indianer sich nicht auf die traditionelle Kriegsführung einlassen wollten, dann führte man gegen diese ganz anderen Menschen, eigentlich Tiere, eben einen ganz anderen Krieg, und es war so jedermann klar, daß die Indianer nicht so waren wie die Yankees und die Existenzberechtigung verwirkt hatten.
Die Konstituierung Amerikas, der „pursuit of happiness“, duldet also keine Hemmnisse – dem Glück Steine in den Weg zu legen, ist unmenschlich und unamerikanisch. Reichen die eigenen Kräfte zum Wegräumen der Steine nicht aus. ist der starke Arm des Staates zur Stelle.
Der Sezessionskrieg: The Birth of a Nation
Daß dieses Prinzip es ebenfalls nötig macht, den eigenen Reichtum und die individuelle Wohlfahrt zu vernichten, und daß dies eine vom Staat vollzogene und von den Bürgern gewollte Tätigkeit ist, haben die Amerikaner an sich selbst demonstriert: Im „Bruderkrieg“ haben sie gezeigt, daß Leistung an sich noch gar nichts ist, sondern daß sie sogar zum Hindernis werden kann und zerstört werden muß, wenn sie nicht den Kriterien kapitalistischer Rationalität folgt. Zur schrankenlosen Entfaltung der Leistungsgesellschaft gehört die beständige Vernichtung von Leistungswille und -fähigkeit sowie von aller nicht dem kapitalistischen Zweck gemäßen Tätigkeit.
Der amerikanische Sezessionskrieg, der in einer ,,now at last truely continental economy“ resultierte (Observer, 28. März 1976), stellt die ,,birth of a nation“ dar, so W. D. Griffith's Bürgerkriegsfilm, in dem er die Schranke beseitigte, die durch die Sklaverei in den Südstaaten dem „free enterprise“ in den Weg gelegt wurde. Sklaverei bildete ein Hindernis für die Entfaltung des Prinzips des Selbermachens, was so ausgedrückt werden kann:
,,Dennoch hatten sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Gegensätze zwischen den Industriestaaten im Norden und Osten sowie den Baumwollstaaten im Süden verschärft. Die Einkommens- und Vermögensunterschiede (!) zwischen den Regionen waren wesentlich größer geworden. Dies war großteils eine Folge der Sklavenwirtschaft auf den Großplantagen. Sie machte es möglich, daß sich im Süden eine unwahrscheinlich reiche ( ! ) Pflanzeraristokratie entwickelte. Der Einsatz der schwarzen Sklaven war deshalb (!) so profitabel, weil aus klimatischen Gründen die Sklavenhaltung sehr billig war.“ (Kleiner Wirtschaftsspiegel)
Die Gegenüberstellung von Reichtum und Gewinn, denn den „neidvoll nach dem Süden blickenden Nordstaaten“ waren die „Vermögensunterschiede“ und der Reichtum der Pflanzerklasse ein Dorn im Auge, demonstriert, worin die durch Sklaverei geschaffene Schranke bestand. Der aus der Mehrarbeit der Sklaven herausgepreßte Reichtum war etwas, an dem das ,,free enterprise“ nicht partizipieren und zur Profitunterstützung einsetzen konnte. Gleichermaßen waren die Leute, die schufen, nicht frei und somit keine Kunden. Daß die Sklavenhalter die absolute Verfügungsgewalt über die Sklaven hatten, machte aus Sklaverei eine einträgliche Einrichtung, deren Grundlagen allerdings im Gegensatz zu den Yankeeinteressen standen.
Sklavenhaltung basiert auf natürlichen Voraussetzungen: dem schwarzen Arbeitsvieh und unbegrenztem Landvorrat. Sklaven – ohne eigenes Interesse bei der Arbeit – ermöglichen nur extensiven Raubbau auf natürlich fruchtbarem Boden, woraus die ständige territoriale Ausbreitung der Südstaaten und folglich die Einschränkung kapitalistischer Absatzmärkte sich ergaben.
Wenn so Geschäft auf Geschäft prallt, entscheidet wieder mal die Gewalt, nun aber, da es nicht mehr um Individuen, sondern um Klassen geht, nicht länger die Gewalt des einzelnen und seiner Faust, Kanonen und Soldaten als staatlich monopolierte Kampfmittel und staatlich verpflichtete Bürger müssen her.
Wenn das Amerika vor dem Bürgerkrieg charakterisiert wird als –
„secure behind two great oceans, their country had little to fear from others and was usually able to do without an army, a navy. a foreign policy, or indeed a government“ (Observer Magazine)
so werden amerikanische Historiker nicht müde, die Leistungen Abraham Lincolns zu preisen, daß er in kürzester Zeit die moderne Kriegsmaschinerie aus dem Boden stampfte – die Demonstration dessen, daß „without a government“ gerade die gewalttätige Unterwerfung der eigenen Leute durch den Staat umfaßt, wo deren Nützlichkeit für das Geschäftemachen in Frage gestellt ist. Wenn also eine bestimmte Sorte von Bürgern die amerikanische Lebenskultur ganz auf sich gestellt durchsetzt, dann brauchen sie gerade dafür den Staat: er muß zum einen gewährleisten, daß sie es selber machen können, dann aber gewaltsam eingreifen, wenn die Konsequenzen ihres Handelns ein weiteres Handeln in ihrem Sinne unmöglich zu machen drohen und der Vorteil des Kapitals gefährdet ist.
Der Bürgerkrieg trieb dieses Verhältnis auf die Spitze, indem der Schlag der Staatsgewalt gegen einen Teil seiner eigenen Bürger ging, die auf ihre Art dem amerikanischen Prinzip, jeder nach seinem Nutzen, gehorchten. Daß diese auf Kosten der übrigen Teile der Union zu gehen drohte, war der Grund, der verstockten Pflanzeraristokratie einzubleuen, daß Nutzen immer noch bedeutet: Nutzen des Kapitals.
Die durchgesetzte Konkurrenz ...
An der Konstituierung ihres Landes haben die Amerikaner vorgeführt, wozu die Segnungen der neuen Welt dienen. Die unbeschränkte Durchsetzung der Konkurrenz enthielt stets die einseitige Bereicherung der Geschäftemacher, was zur Ergänzung dieses gnadenlosen Erfolgsprinzips die nackte Gewalt des Staates da voraussetzte, wo es nicht funktionierte. Dem Erfolgsprinzip zum Sieg zu verhelfen, war der erste Schlag, der die Schranken durch die eigenen Leute niederriß. Die Errungenschaft, das Recht des Stärkeren in allem zu praktizieren, gegen die gewaltsam aufrechtzuerhalten, deren Bestehen in der Konkurrenz ihren Schaden einschließt, war der zweite Akt. Wer die Härte der Chancengleichheit nicht hinnimmt und auf seinem Wohl besteht, gefährdet den ,,American way of life“, sodaß der Staat ihm einzuhämmern hat, daß der amerikanische Weg immer noch der beste ist, weshalb dann auch Zweifel an der ,,manifest destiny“ unamerikanische Aktivitäten sind.
Im Süden ließ sich das einfach machen, was sich noch heute an der nicht vorhandenen gewerkschaftlichen Organisierung der schwarzen und weißen Arbeiter mit der Ausnahme der Industriezentren zeigt. Seit der Freilassung der Neger sorgt der ,,Neue Süden“ mit anderen Methoden dafür, daß wie ehedem der „gesellschaftliche Platz der Schwarzen“ fixiert ist, ein Umstand, der für den SZ-Schreiberling umso erfreulicher ist, weil der Nigger ja als ,,billige Arbeitskraft weiterhin willkommen“ ist für die „einzige Tätigkeit“ die sich ihm bietet, nämlich des Landarbeiters oder Hilfsarbeiter in den südlichen Industriedörfern (SZ 18. März 1970).
Die Segregationsgesetze der Südstaaten sind das Mittel gewesen, die optimale Ausbeutung der Arbeitskraft der Schwarzen abzusichern und zugleich dafür die Bedingungen zu schaffen, daß die weißen Arbeiter sich in die Abhängigkeit von den Bossen begeben, die aufpassen, daß die Neger auf dem Platz bleiben, der ihnen zukommt. Die ,,white supremacy“ im Süden, früher in der Bundesgerichtsentscheidung über die schwarzen Bürger („seperate but equal“) fixiert, setzte sich auch gegen die förderale Civil Rights Legislation durch, zumal der Staat sich mit dem demonstrativen Einsatz der Nationalgarde begnügte. Die Konkurrenz schafft sich in Amerika also die Staatsform, die sie braucht. Wo Schwarze diese Gewalt nicht anerkennen, die sie zu den willkommenen Billigstarbeitskräften stempelt und damit den weißen Arbeitern ihren Vorteil läßt, immer noch besser in ihrem Elend dazustehen, reagieren diese mit Lynchterror und Ku-Klux-Klan-Banden, um damit zu verhindern, daß die Schwarzen mit ihnen gleichziehen und ihre Konkurrenz verschärfen. Der Interessengegensatz zwischen Arbeit und Kapital wird auf die mörderische Weise ausgetragen, daß gegen die Nichtanerkennung seines „gesellschaftlichen Platzes“ seitens der Nigger jedes Mittel gerechtfertigt ist. Diese Gewalttätigkeit derer, die selbst Opfer sind, trichtert denen, die noch mieser dran sind als sie, ein, daß sie selber ihre Lage verschulden und daß jeder das bekommt, was er verdient. So garantieren diese Prozeduren das Wohlverhalten der weißen Arbeiter gegenüber denen, die sie selber ausbeuten.
Da im Süden also die Konkurrenz der Arbeiter soweit geht, daß ein Teil von ihnen tendenziell aus der Konkurrenz herausfällt, muß hier irgendwann der Staat eingreifen, denn ein toter Arbeiter ist kein guter Arbeiter. Im Norden war dies immer schon anders, da aufgrund der amerikanischen Landnahme der Druck der Arbeiter gegeneinander sich im Westen fortpflanzen konnte, zugleich während der Bonanza-Jahre des US-Kapitals ein hohes Lonniveau herrschte, weil das Kapital ständig Arbeiter benötigte, um die Produktion für die durch die Erschließung Amerikas gewonnenen Absatzmärkte auszudehnen. Damit war für die Arbeiterklasse im Unterschied zum europäischen Kapitalismus von alleine gesorgt und der Staat brauchte sich darum nicht zu kümmern. Mit den ständig wachsenden Einwanderermassen und gleichzeitiger hoher Kapitalproduktivität nahm der Druck jedoch kontinuierlich zu und setzte sie den übelsten Machenschaften des Bis Business aus, wofür die Company Towns augenfällige Beispiele sind. Die Reaktion der Arbeiter, sich gegen die ihnen aufgezwungene Verschlechterung ihrer Reproduktion zur Wehr zu setzen, rüttelte an den Grundfesten der Überzeugung, daß die Konkurrenz durch ihr eigenes Funktionieren für den Nutzen des Kapitals zu sorgen hat: Was die Arbeiter machen, hat immer den „vollen Fluß der Wirtschaft zu fördern“ (Taft-Hartley-Act).
„The Business of America is business“, erklärte Präsident Coolidge und machte damit kenntlich, daß in Amerika nur der zählt, der keine Störung für's business bringt. Der radikale Widerstand der Arbeiter gegen die Zerschmetterung ihrer Lebensideale und Träume von der schönen neuen Welt konnte von der Konkurrenz nur dadurch gebrochen werden, daß der Staat sie mit seinen Methoden aufrechterhielt: Der Einsatz von Bundestruppen als Streikbrecher, Nationalgarde und Polizei gegen streikende Arbeiter, sorgt mit nackter Gewalt dafür, daß diese sich gemäß des Konkurrenzprinzips verhalten. Für die Staatsmacht war die Weigerung der Arbeiter, die Resultate der Konkurrenz hinzunehmen, die ihnen bei härtester Anspannung nicht das Lebensnotwendige läßt, der Anlaß, ihre Zurückhaltung aufzugeben und ihnen den sozialen Frieden aufzuzwingen. So hält in Amerika der Staat mit offener Gewalt die „Stützpfeiler der modernen Industrie“ (so ein amerikanischer Sozialkritiker 1912) aufrecht: |
 |
„Intensiv organisiertes und geschütztes Kapital und eine Arbeiterschaft, die in sich heftig konkurriert.“ (Spiegel Nr, 46,1975)
Die amerikanischen Gewerkschaften sind die dementsprechende Form, die die Arbeiter fanden, um gemäß amerikanischen Verhältnissen ihren Widerstand fortzusetzen.
Daß in der uneingeschränkten Konkurrenz nur der zurandekommt, der alle Register gegen die anderen ziehen kann, kennzeichnet auch die amerikanische Gewerkschaftsbildung. Die ersten amerikanischen Gewerkschaften waren berufspezifisch organisierte Facharbeiterverbände mit dem Zweck, über die als „business agents“ bezeichneten Gewerkschaftsfunktionäre so hohe Löhne wie möglich auf Kosten aller anderen Konkurrenten für ihre Mitglieder herauszuschlagen, ein Verfahren, das die American Federation of Labor (AFL) zum Prinzip macht. Durch die Absonderung der qualifizierten Arbeiter von den ungelernten wichen die ersteren der zunehmenden Konkurrenz unter den Arbeitern aus. Diese wurde durch das beständig zunehmende Angebot an ungelernten Arbeitern verschärft, die sich aus den europäischen Einwanderern rekrutierten, welche wiederum im eigenen Land gescheitert oder mit den modernen Flausen im Kopf, bis zum äußersten entschlossen waren, ihre Zugehörigkeit zur fortschrittlichen Menschheit ohne alle Klagen und ohne Aufmucken zu beweisen.
Anders als hierzulande betrieben die US-Gewerkschaften die Durchsetzung der Arbeiterinteressen gegen das Kapital von vorneherein durch die Organisierung der Konkurrenz unter den Arbeitern (die in den gelben Gewerkschaften, die auf der Basis einzelner Betriebe gebildet wurden, um andere Arbeiter auszuschließen, auf die Spitze getrieben ist), reagierten einzelne vom Staat niedergeschlagene amerikanische Gewerkschaften wie die American Railway Union (ARU) und vor allem die International Workers of the World mit dem Versuch, die Arbeiter nach Industriezweigen zu organisieren.
Die IWW mit ihren eindeutig anarchistischen Tendenzen reagierte auf die gewaltsame Unterdrückung der Arbeiterklasse ebenso, um wieder die volle Handlungsfreiheit der Arbeiter herzustellen. Sie verkörpert also in extremer Weise den Glauben des Amerikaners an die Ideale seiner Welt, wofür er auch zu den schärfsten Mitteln greift, nicht um den Grund für deren ständige Negation zu beseitigen, sondern um sie sich zu erhalten. Es ist also nicht verwunderlich, daß John Steinbeck mit seinen Romanen über die IWW zum anerkannten Literaten werden konnte.
Hatte die amerikanische Staatsgewalt den Kampf der Arbeiter gegen das Kapital durch das Einsetzen von Staatsmiliz und Bundestruppen zur Unterdrückung von Streiks niedergeschlagen, so offenbart die Anwendung des Sherman-Anti-Trust-Gesetzes auf den durch die ARU organisierten Pullmannstreik, daß die Verfolgung der Arbeiterinteressen Unterwerfung unter die Despotie des Kapitals zu heißen hatte: geschlossene Gewerkschaftsbildung in einem Industriezweig bildete laut Bundesgerichtshof einen „Anschlag auf den freien Fluß der wirtschaftlichen Tätigkeit“. Damit war im Sinne des Kapitals eingeschränkt, was Gewerkschaften durchsetzen konnten, indem ihnen die Gewerkschaftskonkurrenz von staatswegen aufgezwungen wurde. Auch die Gründung des Committee for Industrial Organisation (CIO), die inzwischen mit der AFL in einem Dachverband zusammengeschlossen ist, und die Industriegewerkschaften organisierte, ändert daran nichts. Daß das Gegeneinander der Arbeiterfraktionen für diesen Zusammenschluß ein „no V-raiding-agreement“ notwendig machte, das das gegenseitige Mitglieder-Abjagen unter Sanktionen stellt, zeigt, daß die amerikanischen Gewerkschaften dem amerikanischen Konkurrenzprinzip entsprechen: sie machen die Konkurrenz untereinander zum letzten Selbstzweck. Jede einzelne Gewerkschaft braucht deshalb möglichst viele Mitglieder, um nicht im Konkurrenzkampf mit den anderen Gewerkschaften unterzugehen.
Die Konkurrenz ist ein gnadenloses Geschäft und jeder spürt ihre Faust so sehr im Nacken, daß er sich zu den härtesten Anstrengungen gezwungen sieht. Daß dies immer die Wendung gegen die anderen bedeutet, wird am Beispiel USA nur besonders deutlich, wo selbst die Gewerkschaften, ansonsten dafür da, die Arbeiter vor sich selbst zu schützen, von ihnen gegen ihre selbstzerstörerische Konkurrenz untereinander institutionalisiert, zum ausdrücklichen Kampfmittel von Arbeiterfraktionen gegeneinander werden.
Die Gewerkschaften – ein Verbrechen?
Die enge Verbindung mit dem organisierten Verbrechen gibt den ideologisch sehr nützlichen Vorwurf ab, die Gewerkschaften seien überhaupt Verbrecherorganisationen, also die Arbeiter, die zu sehr auf ihrem Wohl beharren, Verbrecher. Zwar anerkennt der Amerikaner das organisierte Verbrechen als zu Amerika gehörigen Bestandteil – ist doch zwischen der harten Bandage, die man im „struggle for life“ braucht, und dem Hufeisen im Handschuh, auf das man in den reichlich vorhandenen schwierigen Lebenslagen einfach nicht verzichten kann, ein fließender Übergang, doch hier stehen zum einen zu schroff ehrliche Arbeit und ihr Komplement, Kriminalität, nebeneinander, zum anderen gewinnen die Gewerkschaften dadurch eine Stärke, die ihnen von den Mitgliedern her nicht zukommt, und sie halten auf diese perverse Weise am Interessengegensatz zum Kapital fest: sie reagieren auf ihre innere Schwäche durch Anlehnung an die einzige Gewalt, die ihnen zur Verfügung steht. Es ist also nichts Zufälliges an dieser Koalition. Die Herumgestoßenen und Feinde der Konkurrenz tun sich zusammen, um in ihr zu bestehen. Der Bürger fürchtet sich davor, daß die in der Konkurrenz Geschlagenen alle seine Werte unterlaufen und deren schmutzigen Kern – Bereicherung auf Kosten der anderen nicht als Versager hinnehmen, sondern in Reduktion auf nackte Gewalt gegen die immer gleiche Richtung der Bereicherung Widerstand leisten, ja sie sogar umkehren, ohne natürlich an der Konkurrenz selbst zu rütteln.
„Bei ihren Filmen hat man den Eindruck, als würde sich Verbrechen lohnen? – Ich antwortete: Verbrechen lohnt sich.“
Sam FULLER über sein Verhör beim House Commitee on Unamerican Activities
Während es den Gewerkschaften in diesem Bündnis darum geht, für ihre Mitglieder eine Kompensation für die alltägliche Schädigung im Arbeitsleben zu erreichen, bricht der Verbrecher die Regeln der Konkurrenz, um gemäß der Maxime „Jeder sucht seinen Vorteil“ auf seine Weise an den Früchten des Erwerbslebens teilzuhaben, da sie mit ehrlichem Erwerb nicht einzuheimsen sind. Auch das ist nichts besonderes an den USA. Auffällig ist hingegen das Ausmaß und der Organisationsgrad des Verbrechens. Das öffentliche Leben hat sich arrangiert mit der Tatsache, daß nicht unbedeutende Teile seiner selbst und auch nicht unbedeutende Personen, vom Schauspieler bis zum Cop, davon gesteuert werden. Da die Leistungsgesellschaft nicht abgeht ohne Verbrechen und der amerikanische Staat eine auf die Spitze getriebene Leistungsgesellschaft abzusichern hat, muß er die monströse Kriminalität hinnehmen und sich ihrer teilweise sogar als integrierenden Moments bedienen (so garantiert z. B. das Zweckbündnis der Gewerkschaften mit der Mafia, daß hier nur nach den Geschäftsgrundsätzen der Gangsterlogik verfahren und jede staatsfeindliche „Ideologie“ im Keim erstickt wird.) – was den Kampf gegen die übelsten Auswüchse natürlich beinhaltet. Letzteres ist wiederum abhängig vom konjunkturellen Auf und Ab: ob man Harlem unter Heroin setzt, ist eine Frage der Zweckmäßigkeit und Kosten einerseits, und des sozialen Friedens andererseits.
Das organisierte Verbrechen braucht Kapital in nicht unbedeutender Menge – darin zugleich der äußerliche Übergang zur Wohlanständigkeit – um sich zu konstituieren. Der amerikanische Staat verhalf ihm dazu mit einer historisch berühmten Maßnahme: der Prohibition. Historiker und Liberale aller Art sprechen hier gerne von einem Fehler des Staates, was aber die Zwangsläufigkeit des staatlichen Eingriffs wie auch sein zwangsläufiges Scheitern kaschiert. Ganz offensichtlich soffen sich die Leute zu jener (?) Zeit arbeitsunfähig. Da sie sich damit schon selbst aus dem Verkehr zogen, konnte die Konkurrenz dieses Fehlverhalten nicht einschneidend bestrafen bzw. ließ den Schnaps nur noch reichlicher fließen; der Staat – in konsequenter Verlängerung seiner Aufgabe, die Arbeiterklasse niederzuhalten – mußte her und den Leuten ihre widerborstigen Gefühle aus bzw. sie zur Vernunft treiben, wofür er noch die religiöse Rechtfertigung von dem Temperenzlern frei Haus geliefert bekam. Erlaß eines Verbots und seine Durchsetzung sind zweierlei: das dringende Bedürfnis nach Alkohol (in den Filmen immer von gut gekleideten Herrschaften in nobel eingerichteten Spezialclubs befriedigt – auch eine Art, die Unzufriedenheit des gemeinen Volkes als Angelegenheit aller darzustellen) setzte sich in genügend zahlungskräftige Nachfrage um, um die staatliche Sanktion angesichts der gigantischen Profite gering erscheinen zu lassen. Hinzu kam die Freunde der Betrunkenen, die den Schnapslieferanten den Hintergrund öffentlicher Sympathie und passiver Unterstützung schuf. In umgekehrtem Verhältnis dazu wurden die staatlichen Maßnahmen immer schwächer, konnten kostenmäßig nicht mithalten (von den 2000 Prohibitionsagenten ging der Großteil zum besser zahlenden Feind über), bis sie schließlich eingestellt wurden, was der Nation ein überschwengliches Feuerwerk verschaffte und den Verbrechern ein ausreichendes Grundkapital sowie die Spitzenposition in der Welt. Betrachtet man die heutigen Alkoholgesetze („trockene Staaten“ etc.) so weiß man, wie es heute mit dem Alkoholkonsum steht ...
Daß es die Prohibition brauchte, macht zwar den Kern des Gangstertums sehr schön klar, ist aber nur ein zufälliger Anlaß, der sich in einer Gesellschaft, die so sehr auf hinterfotzige Tricks im Arbeiterkampf, Glücksspiel, Prostitution, Drogen, illegale Einwanderer u. ä. angewiesen ist, auch anderswo gefunden hätte.
Auf seine Weise sorgt also das organisierte Verbrechen für die Aufrechterhaltung einer sich beständig ins Chaos treibenden Konkurrenz, indem es sowohl die nötigen Dienstleistungen zur Verfügung stellt als auch die outdrops in ihr festnagelt. Hinzu kommt der nicht zu unterschätzende Beitrag zum „melting pot“, daß nämlich eine Reihe ethnisch gebundener Bevölkerungsgruppen, die von Haus aus die Voraussetzungen für die Leistungsgesellschaft nicht mitbringen, hier Betätigung, Schutz und Integration finden, angefangen mit den Rekruten der Straßengangs – aufs glücklichste verbinden sich in dieser Hinsicht die Weite des Westens und Verbrechen der Großstadt. Von den Italienern, deren Namen mittlerweile nicht einmal mehr Ausspracheschwierigkeiten bereiten, muß bezeichnenderweise mindestens einer in jeder Fernsehserie auf Seiten des Gesetzes vorkommen. Daß das organisierte Verbrechen ein ausgezeichnetes Sprungbrett zur vollen gesellschaftlichen Anerkennung ist, zeigt sich umgekehrt an den großen Gangstern, die jeder landsmannschaftlichen Besonderheit entkleidet, in nützliche Tauschhandel mit Politikern eintreten können und vom gewöhnlichen Kapitalisten nach außen hin in nichts sich unterscheiden. Die höheren Chargen wissen um ihre gesellschaftliche Bedeutung und treten darum schon seit jeher sehr selbstbewußt in die Öffentlichkeit, welche sie mit der gebührenden Mischung aus Abscheu und Faszination betrachtet. Diese Männer haben sich auf ihre Weise dem Diktat amerikanischer Lebenskunst unterworfen, man kann ihnen den Respekt nicht verweigern.
Der unaufhaltsame Aufstieg einer Großmacht ...
„Wenn hohlköpfige Kritiker das zu unserem privatkapitalistischen System gehörige Motiv des Profits mies machen, so ignorieren sie die Tatsache, daß es wirtschaftliche Grundlage all der Menschenrechte ist, die wir besitzen, und daß ohne es alle Rechte bald verschwinden würden.“ (Dwight D. Eisenhower)
Nicht erst am Phänomen der geschäftsmäßigen Organisierung des Verbrechens ist also klar geworden, auf welche Art und Weise und um welchen Preis die amerikanische Leistungsgesellschaft ihren Fortschritt und damit Bestand sichert. Das Geschäftemachen hat hier die ungehemmtesten Voraussetzungen und daher die selbstzerstörerische Resultate, sowie die nötigen radikalen Heilmittel. All das, was dieses Land an Ungeheuerlichkeiten hervorbringt, ist sein Fortschritt und seine Größe, was in dem Gemeinplatz, in Amerika sei alles ins Überdimensionale gesteigert, jedermann geläufig ist.
Der Gemeinplatz trifft etwas richtiges: in Amerika ist es grundsätzlich nicht anders als hierzulande, nur eben viel größer, Amerika hat es besser, den traditionelle Schranken der Kapitalentwicklung sind nicht vorhanden und das unbändige Streben nach Profit entfaltet sich von vornherein auf einem in jeder Hinsicht größeren Felde. Hier endet jedoch die Weisheit des Gemeinplatzes, und er bringt nur noch das unbestimmte Gefühl zum Ausdruck, daß das hier Vertraute sich dort drüben auch ganz schön schlimm entwickelt habe – und verdrängt so, was damit über die eigenen Verhältnisse gesagt ist Der Witz am US-Gigantismus ist, daß dieses Land sich selbst zu klein ist, daß die unerhörten Voraussetzungen der Kapitalakkumulation in schöner Konsequenz in Schranken eben dieser Akkumulation umschlagen.
Seine erste große Bewährungsprobe bestand der US-Kapitalismus im Sezessionskrieg.. In dieser mörderischen Auseinanderstzung wurde jedoch klar, daß die USA sich so etwas nicht noch einmal leisten konnten: die Tatsache, daß der Kapitalismus die Menschen aufeinanderhetzt, darf nicht bis zur Gefährdung der nationalen Einheit gehen. Hier wie anderswo sorgt die gewaltsame Klammer des Staates dafür, daß die Bürger keine Kriege untereinander Uhren – wofür sie Grund genug hätten –, sondern sich nach Recht und Gesetz gegenseitig fertigmachen.
Jedoch ist es die Besonderheit des amerikanischen Staates, daß er für den Zusammenhalt seiner Bürger nach innen hin mit ihrer Übereinstimmung nur wenig tut, und wenn er es tut, dann entweder halbherzig oder sehr kräftig, wenn nämlich in bestimmten Ausnahmesituationen der volle Einsatz des Gewaltapparates gefordert ist. So fällt an den Amerikanern auf, daß sie glühende Vaterlandsliebe mit weitreichendem Desinteresse an ihrem Staat verbinden, daß es ihnen überhaupt kein Widerspruch ist, ihren Amerikawahn durch deutlichste Demonstration lokalpatriotischer Borniertheit und Eigenbröteln zu desavouiren, daß sie – in einem Wort – Nationalisten, aber keine Parteigänger des Staates sind. Die Tatsache, daß ihr Staat sie in einer uneingeschränkten Konkurrenz gegeneinander antreten läßt, ohne sie sie bis zur letzten Konsequenz austragen dürfen, drücken sie in ihrem verqueren Bewußtsein selbst aus.
Damit der US-Kapitalismus funktioniert, müssen diese Leute stolz sein auf ihr Land – sie sind stolz auf ihr Land, weil der Kapitalismus, der sie tagtäglich den übelsten Prozeduren unterwirft, funktioniert. Sie sind also einig mit den amerikanischen Geschäfts- und Lebensprinzipien als ihren eigenen und verhelfen so dem amerikanischen Kapitalismus zu seinen Erfolgen.
Der amerikanische Imperialismus
„Da es für den Handel keine nationalen Grenzen gibt und der Industrielle die gesamte Welt als Markt verlangt, muß die Flagge seiner Nation ihm folgen; und die Türen jener Nationen, die verschlossen sind, müssen niedergerissen werden.“ (Woodrow Wilson)
Die ungebrochene Entfaltung, der Kapitalgesetze treibt die Kapitalisten, nach Zurichtung des eigenen Landes, auf Gedeih und Verderb in die Welt hinaus. per gigantischen Profitmaschinerie ist das eigene Land bald zu klein, die Gesellschaft kann nur bestehen, wenn sie sich die Welt annektiert (wobei man freilich auf den Widerstand anderer kapitalistischer Länder trifft, denen es genauso geht). Dies ist allerdings keine Frage des Bewußtseins der Leute mehr, nicht für sie geschieht diese epochale Veranstaltung, sondern sie vollziehen die amerikanische Herrschaft als ihren eigenen Willen mit, obwohl sie absolut nichts davon haben. Ihre Gemeinsamkeit, deren materielle Grundlage gerade ihr Gegeneinander ist, machen sie sich vor über die Außenpolitik, die Stellung ihrer Nation in der Welt. Daß die Amerikaner angesichts der Sternenfahne beten, oder – etwas profaner – die Hand auf's Herz legen, ist die exakte Geste für 200 Millionen Leute, die sich ihre eigene Existenz verhimmeln wollen und müssen: alles, was ihre Gemeinsamkeit nicht ist und sie gerade in ihrem individuellen Leistungswahn festhält, und sie doch mehr oder minder gewaltsam an ihre Pflicht zur Gemeinsamkeit erinnert, ist in Religion und Fahne enthalten. Mit Inbrunst betrügen die Amerikaner sich selbst mit Symbolen, die sie als ihre eigenen ansehen – noch im Armenhaus trösten sie sich mit ihrer Mitgliedschaft in einer göttlichen Gemeinde und einer mächtigen Nation. Es ist so auch verständlich, warum die Kommunisten dort kein Bein auf die Erde bekommen: Da die Herstellung dieser Gemeinsamkeit das mit äußerster Anstrengung und größten Opfern an Leib und Verstand vollzogene Werk der Amerikaner selbst ist, das sie brauchen, um weitermachen zu können in ihrem Glauben, die Kapitalexpansion auf ihrer Konkurrenz und dem immergleichen Profitieren nur einer Sorte von Konkurrenten eben davon beruht, muß jede revolutionäre Agitation als unmittelbare Bedrohung ihrer eh schon zerbrechlichen Existenz, als unamerikanisch gelten. Womit sowohl ein McCarthy mit seinem „Ausschuß gegen unamerikanische Umtriebe“ erklärt wäre, wie auch die aberwitzige Konsequenz, daß manche Linke im Verein mit den reaktionären Säcken eine Rückkehr zu den Idealen des jungen Amerika fordern: Menschenrechte, Demokratie, Enthaltsamkeit des Staates, Würde der Nation ..., wie auch die makrobiotischen Landkommunen der Hippies, die abseits der Konkurrenz Gründerväter spielen.
... und sein Staat
Damit der Amerikaner sich seinen Stolz bewahren kann, braucht es einen Staat, der diese Notwendigkeit nach außen hin durchsetzt, einen mächtigen Staat. Plötzlich rückt er in das Zentrum aller Überlegungen, die sich die Amerikaner über sich selbst als Amerikaner machen, plötzlich können die Staatsmänner nicht entschieden und mächtig genug, Pentagon und Office for Foreign Affairs nicht mit genug Mitteln ausgestattet sein. Mit gutem Grund stellen die Amerikaner hohe Ansprüche an das Weiße Haus: ihr persönliches Wohlergehen, so meinen sie, ist gefährdet, wenn nicht der Präsident dafür sorgt, daß der American way of life überall auf der Welt seine Einfallsschneisen für die Kapitalakkumulation schlägt. Den Kapitalisten ist dies nicht möglich, denn es fehlen ihnen die Soldaten und die Kanonen. Diese beansprucht der Staat ausschließlich für sich, denn nur er ist fähig zu sachgemäßem Umgang damit zum Wohle der Nation und aller ihrer Mitglieder.
Den Beweis dafür ist der US-Staat unzählige Male angetreten. Wir verzichten auf historische Belege des amerikanischen Imperialismus, eine ewige Litanei von Gebeten und skurpellosem Zuschlagen, hehren Idealen in den Herzen der sonny boys und Massakern, Völkerfreundschaft und Verachtung für die unzivilisierte Menschheit, da in dieser Zeitung schon genug davon zu lesen war. Hier nur noch einiges zur Erklärung der weltweiten, gewalttätigen Präsenz:
Da sich die USA ihre eigene Weltöffentlichkeit sind, entstand aus der Tatsache, daß in der Außenpolitik kein Recht, sondern nur die Gewalt herrscht, für den amerikanischen Staat kaum das Problem, sich mit der Rechtfertigung und Verhüllung seiner Gewaltmaßnahmen herumschlagen zu müssen: seine Bürger sind das ja gewöhnt.
Das Ausmaß des US-Kapitalismus bestimmt auch das Ausmaß der Expansion: was gebraucht wird, muß man sich nehmen, denn wo es um Großes geht, heiligt der ganze Erdball den amerikanischen Zweck.
Dieser Imperialismus war nie vorrangig am Funktionieren des Welthandels interessiert, da der Export aufgrund der überragenden Stellung des Dollars nicht das besondere Anliegen der Amerikaner ist. Ihnen geht es um Ausplünderung natürlicher Reichtümer und Besitznahme der Warenwelt: die Rohstoffe müssen möglichst billig eingeführt werden und der ständig wachsende Kapitalüberschuß muß sich in Kapitalexport, d. h., Errichtung amerikanischer Firmen in der ganzen Welt, Überschwemmung des jeweiligen Marktes mit dort produzierten Waren niederschlagen – anschließend der Retransfer der erzielten Gewinne aus der damit zum amerikanischen „Billiglohn-Land" gemachten Welt (dies übrigens auch ein Hinweis darauf, was die amerikanischen Arbeiter vom Stolz auf ihre Leistungsgesellschaft haben). Woraus sich dann schlüssig ergibt, daß die „politische Stabilität" der restlichen Welt tiefstes Anliegen des amerikanischen Staates sein muß.
Der Inhalt eines jeden Wahlkampfes für die Präsidentenwahl ist damit geklärt: der Staat soll sich weniger in die Rechte der Bürger einmischen, Amerikas führende Stellung in der Welt muß gesichert und ausgebaut werden. Nun ist in diesem 200jährigen Jahr alles anders – eine Schicksalswahl steht bevor. Die Bürger sind tief beunruhigt, jeder Politiker spricht von einer Erneuerung Amerikas, womit er ausdrückt, daß alles so bleiben soll, wies ist, aber nicht so, wie's zuletzt war.
Daß es in Amerika zuletzt nicht mehr ganz gestimmt hat, merkt der aufmerksame Leser daran, daß die zuvor gegebene Charakterisierung des amerikanischen Imperialismus nur noch bedingt zutrifft: die USA kümmern sich neuerdings um den Welthandel, sie haben Angst vor der Weltöffentlichkeit, sie sind vorsichtiger geworden im Einsatz ihres Gewaltapparates. Die perfiden East-Coast-Liberalen drücken auf ihre unnachahmliche Art aus, was geschehen ist: „America lost its innocence in Vietnam.“ Jahrzehntelang hat der amerikanische Staat haarscharf dasselbe getrieben – aber nun ist plötzlich die „Unschuld“ beim Teufel. Der Grund für solch schmutzige Sprüche liegt auf der Hand: die Amerikaner haben verloren.
Damit ist das ganze Drama aber noch nicht beschrieben: sie haben verloren, weil ihr Imperialismus einfach nicht mehr so ungebrochen die Welt beherrschen kann. Die militärische Vorherrschaft ist durch die Sowjetunion und die Befreiungsbewegungen gebrochen, die wirtschaftliche durch Japan und die Länder der Europäischen Gemeinschaft, die sich mittlerweile auch ans Kapitalexportieren und Rohstoffausbeuten machen. Während das militärische Problem schon seit der Cuba-Krise die Präsidenten Kennedy, Johnson und Nixon beschäftigte und sie zu massiven Großmachtdemonstrationen veranlaßte – natürlich nur, um den gefährdeten Frieden wieder zu stabilisieren –, und sie ähnliche Töne anschlagen ließ, wie die Wahlkämpfer heute, sind wirtschaftliche Probleme erst seit 1969 akut: die mal wieder fällige Krise konnte nicht mehr so unbekümmert auf dem Rücken der übrigen Welt – der Rücken der eigenen Bürger kann bei diesen Dimensionen nie die ausreichende Breite aufweisen – ausgetragen werden, und zwar aufgrund des Aufstiegs neuer Großmächte und der Einschränkung des eigenen Durchsetzungsvermögens.
Wenn Präsidentschaftskandidat Ronald Reagan in seinem Wahlkampf davon spricht, daß Panama die USA bedrohe, ist dies nicht nur ein Scherz, in dem sich die Einschränkung einer Großmacht auf schon kindische Weise ausdrückt, sondern eine gewaltige Drohung steht dahinter: den Angriff auf ihren Imperialismus – von den Bürgern leidenschaftlich als Gefährdung ihrer Existenz bekämpft – werden die USA nicht hinnehmen. Wenn es um den Bestand der Nation geht, werden die Amerikaner in striktester Verfolgung ihrer eigenen Rationalitätskriterien auch wieder einmal ein weiteres Vietnam in Kauf nehmen und das muß nicht unbedingt Panama heißen.
Je mehr jedoch den Amerikanern die Diskrepanz zwischen ihrem Nationalstolz und den Realitäten vor den Kopf gestoßen wird, weil sie die üblen Konsequenzen ihres Alltagslebens nicht mehr unbehelligt auf die restliche Welt ablagern können, desto stärker werden sich Reformer und Faschisten zu Wort melden, um in den USA einiges zu ändern. Da es also noch sehr lange dauern wird, bis die Amerikaner begreifen, was mit ihnen los ist, und die USA abschaffen, hat die Welt noch einiges von den USA zu erwarten.
Über Funktion und Nutzen der amerikanischen Demokratie siehe auch MSZ Nr. 5/1975: „CIA: Krieg im Frieden“.
aus: MSZ 12 – Juli 1976