Heiße Polen-Debatte im Bundestag
DAS PARLAMENT
| Bei den wichtigsten Sitzungen der parlamentarischen Saison wird der Bürger nicht nur durch seine Abgeordneten repräsentiert, sondern er kann seine Vertreter bei der Ausübung ihres Amtes direkt, d. h., in live-Übertragungen des Fernsehens, beobachten. Solche Höhepunkte zeichnen sich durch Länge, Häufigkeit und vermehrte Leidenschaftlichkeit der Diskussionsbeiträge ebenso aus, wie dadurch, daß ausnahmsweise ein relativ hoher Prozentsatz der Volksvertreter überhaupt anwesend ist. Die Verabschiedung des Rentenabkommens mit Polen im Bundestag am 19. Februar war ein solches Ereignis. |
I. Die demokratische Entscheidung
| „Der Bundestag ist die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutsehland und als maßgebliches Gesetzgebungsgremium ihr wichtigstes Organ. Er repräsentiert das deutsche Volk bei Ausübung der Staatshoheit.“ (Staatsbürgertaschenbuch / 93) |
Außenminister Genscher, dem als Regierungsvertreter und Hauptverantwortlichem an der Genehmigung des Vertragswerkes besonders gelegen war, erinnerte daher zu Beginn der Debatte die Abgeordneten ausdrücklich daran, daß sie hier als Repräsentanten des deutschen Volkes Entscheidungen treffen und damit eine hohe Verantwortung tragen: „Diese Entscheidung nimmt uns keiner ab … Jeder muß diese Entscheidung so treffen, als hingen von ihm allein die deutsch-polnischen Beziehungen ab.“ Praktisch hat er selbst diese Entscheidung allerdings bereits vorweggenommen. In der sicheren Gewißheit, daß ihn die Parlamentsmehrheit unterstützen werde, hat er im Sommer und Herbst mit Warschau verhandelt; längst vor der Debatte im Bundestag wußte er (und mit ihm die interessierte Öffentlichkeit) aus Vorverhandlungen, Ausschußsitzungen und Stellungnahmen der einschlägigen Parteivorsitzenden und Fraktionsmitglieder über das Resultat der Abstimmung Bescheid. |
 |
Um alle Zweifel auszuschließen, hatte das CDU/CSU-Präsidium noch zwei Tage vor der Bundestagssitzung seine Begründung für die Ablehnung veröffentlicht (eine „völkerrechtlich wirksame“ Sicherstellung der Ausreise aller polnischen Deutschen verlangt und eine „einwandfreie“ Klarstellung darüber, daß die „finanziellen Vereinbarungen keinen Präzedenzfall für andere Staaten darstellen“) und hatte damit das Signal gegeben für einen ganz normalen parlamentarischen Verlauf der Polen-Debatte im Bundestag: die Regierungs-Koalition würde die Abstimmung aufgrund ihrer Stimmenmehrheit gewinnen; die Opposition dagegen verliert, weil sie über zu wenig Stimmen verfügt (weshalb sie auch in der Opposition sitzt). Die Debatte kann an diesem Ergebnis nichts mehr ändern — auch die paar CDU-ler, die in diesem Fall gegen ihre Fraktionsmehrheit votierten, hatten diese Entscheidung keineswegs im parlamentarischen Prozeß der „Entscheidungsfindung“ getroffen, sondern längst vorher, was ihr Sprecher, Frhr. von Weizsäcker, auch ausdrücklich vermerkt haben will:
„Ich habe jedenfalls unter den Rednern der Koalition keinen gehört, der einen ernstzunehmenden Versuch gemacht hatte, zu verstehen, worum es uns geht.“
Und Wehner spricht, bevor er in die Debatte mit seinen Gegnern von der CDU/CSU einsteigt, dieses parlamentarische Prinzip in der von ihm gewohnten Unverblümtheit aus:
„Glauben Sie bitte nicht, daß ich annehme, ich könnte hier jemand überzeugen.“
Parlamentarischer Überzeugungsfindungsprozeß: Wie findet man eine Mehrheit?
Kein Politiker wäre so naiv, sich von einer Bundestagsdiskussion einen Überzeugungsprozeß der Anwesenden und damit eine Veränderung der Abstimmungsverhältnisse zu erwarten. Und deshalb hatte Genscher auch, als er im Herbst zu den Verhandlungen nach Warschau fuhr, ganz andere Probleme im Koffer als den Bundestag: er konnte gewiß sein, daß die CDU/ CSU an ihrer Ablehnung der Polen-Verträge auch nach einer gegen sie verlaufenen Mehrheitsentscheidung des Bundestags festhalten würde. Und weil die Regierung in diesem Fall von den Stimmen der Opposition abhängig war (im Bundesrat nämlich, wo die Mehrheitsverhältnisse ja bekanntlich anders liegen), mußte sie um deren Zustimmung kämpfen. Und das erfordert nicht bessere Argumente, sondern ein taktisches Fingerspitzengefühl: die CDU mußte zustimmen, ohne nachzugeben, während der Regierung daran lag, zu gewinnen, ohne Zugeständnisse machen zu müssen. Genscher berichtete dem Parlament von seinen diesbezüglichen Anstrengungen:
„Herr Kollege Kohl ...Würden Sie mir bestätigen, daß der Außenminister in der Erwartung nach Warschau fahren durfte, daß wohl ein Land, das von der CDU regiert wird, sich anders verhält als möglicherweise die anderen, ohne daß die anderen schon ihre Position festgelegt hatten?“
Den Abgeordneten, der sich das und vieles andere mehr anhören muß, interessiert das allerdings kaum. Seine Funktion — die Befürwortung oder Ablehnung der Gesetzesvorlagen — erfüllt er durch seine Stimmabgabe.
Wie er sich entscheidet, ist eine Gewissensfrage, die er vorher im Kreise seiner Parteigenossen abgeklärt hat. Eine nähere Befassung mit dem Inhalt seiner Entscheidungen (über 100 Gesetzesentwürfe und noch mehr Rechtsverordnungen pro Jahr) ist institutionell nicht vorgesehen und wird auch nirgends ernsthaft erwartet; dafür gibt es eigene Arbeitskreise und Ausschüsse. Deshalb kommt der Volksvertreter entweder erst gar nicht zu den Debatten oder aber er geht in den eigens dafür geschaffenen Wandelhallen spazieren und wartet auf das Klingelzeichen aus dem Plenarsaal, das ihn dazu auffordert, seiner Pflicht nachzukommen: Klingeln bedeutet Ende der Diskussion, also Abstimmung.
Mangelnde Attraktivität
Diese mangelnde Anteilnahme der Parlamentarier am parlamentarischen Geschehen — immerhin ist der Bundestag „maßgebliches Gesetzgebungsgremium“ und damit wichtigste Institution des Staatsapparates — wird nicht gerne gesehen — erst recht dann, wenn die Repräsentanten nicht einmal zur Abstimmung erscheinen. Im Bundestag wird daher zur Zeit über eine Änderung der Geschäftsordnung beraten, deren
„Schwerpunkt eine Verkürzung der Redezeit (ist), um die Plenarsitzungen attraktiver zu machen.“ (Das Parlament Nr. 9/2).
Denn der Steuerzahler fragt sich angesichts solcher Zustände, ob er Nicht-Anwesenheit nicht als ein Zeichen von Faulheit werten müsse, ob nicht die Volksvertreter eben zum Zwecke der Meinungsbildung qua Diskussion ihre Diäten beziehen und was dieser Zirkus überhaupt für einen Sinn haben soll, wenn der ganze „parlamentarische Entscheidungsfindungsprozeß“ darin besteht, daß stundenlang vor leeren Bänken debattiert wird.
Die politische Aufgabe des Parlaments
Politiker und Politologen aber wissen, daß man es sich mit der Frage nach dem Sinn des Parlaments so einfach nicht machen kann; wenn klar ist, daß die Aufgabe der Diskussionen nicht darin besteht, die Abgeordneten zu überzeugen, so heißt das noch längst nicht, daß die Reden (und damit die Institution Bundestag) überflüssig wären. Ihre eigentliche Funktion erfüllen sie vielmehr im Bezug auf den Bürger. Es herrscht Einigkeit darüber, daß
„die politische Aufgabe eines Parlaments primär nicht darin besteht, bei Ausarbeitung von Gesetzen und der Aufstellung des Haushalts eine detaillierte Mitarbeit vorzunehmen; vielmehr ist es vornehmlich dazu berufen, eine öffentliche Plattform zu bilden, deren sich die Regierung und sonstige Parlamentsmitglieder bedienen können, um für ihre Politik um Vertrauen zu werben, bzw. diese Politik einer Kritik zu unterziehen.“ (Staat und Politik / 237)
Dieser politischen Aufgabe kommen die Diskutanten nach, indem sie ihre Beiträge von vornherein auf die Öffentlichkeit draußen ausrichten, was ihnen von aufrechten Demokraten den Vorwurf einträgt: „Die reden nur zum Fenster hinaus!“. Selbst die „Hinterbänkler“ machen sich diesen Zweck zu eigen, wenn sie sich die Gegenstände ihrer Aufmerksamkeit (d. h. Anwesenheit) nicht nach dem Kriterium der Wichtigkeit, sondern der Öffentlichkeitswirksamkeit der Beratungen aussuchen. Sie bewähren sich als Volksvertreter, indem sie zum richtigen Zeitpunkt die Hand heben und das Ansehen des parlamentarischen Rahmens vor der Öffentlichkeit aufrechterhalten.
Für die Parteien dagegen fungiert das Parlament als Forum ihrer Politik — für die Regierungspartei, die hier der Öffentlichkeit darlegt, warum sie ihre Entscheidungen so und nicht anders treffen mußte; für die Oppositionspartei, insofern sie hier die Gelegenheit hat, sich von eben diesen Entscheidungen zu distanzieren, um damit klarzumachen, daß man alles, was die Regierung falsch macht, auch ganz anders und besser hätte handhaben können.

II. Eine Sternstunde des Bundestags
| „Einig war sich das Haus allein in dem allseitig wiederholt unterstrichenen Willen zur Versöhnung und zum Ausgleich mit dem polnischen Volk.“ (Bericht aus Bonn) |
Noch jeder Redner, ob er nun der Regierung oder der Opposition angehörte, versäumte nicht, vor seinen Ausführungen seinen „Willen zur Versöhnung“ zu betonen und nachdrücklich zu beteuern, daß ihm die ,,Besserstellung der deutschstämmigen Polen“ mehr als alles am Herzen liege. Man war sich also sicher, daß das Beiseiteräumen historischer Barrieren zwischen der VR Polen und der BRD im Interesse des deutschen Staates liegt. Das Verhältnis zwischen dem deutschen und dem polnischen Staat wird „normalisiert“, weil die Entwicklung vorteilhafter „Zusammenarbeit“ auf geregelten zwischenstaatlichen Beziehungen, unter wechselseitiger Anerkennung als souveräne Staaten, beruht.
Dort, wo verbindliche Richtlinien für das Handeln der Regierung „zum Wohle des Volkes“ getroffen werden, streiten sich die Parteien nicht um sich gegenseitig zu überzeugen, und die „historische Wahrheit“ (Kohl) zu finden, sondern um dem Volk, in dessen Namen hier gestritten und entschieden wird, die Entscheidung bzw. ihre Ablehnung plausibel zu machen. Daß es keine Entscheidungen der Bürger sind, auf die gleichwohl Rücksicht genommen wird in den Parlamentsdiskussionen, erklärt denn auch die Art, wie diese Debatten geführt werden.
„Diese Vereinbarungen dienen deutschen Interessen ... sie bewirken auch eine Vertiefung und Erweiterung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit“, versicherte Koschnick für die SPD.
Die „Versöhnung“ mit Polen ist also ein Akt der Staatsräson, der „politischen Vernunft“ (Mischnick), und nicht ein Akt der „Menschlichkeit“ gegenüber dem polnischen Volk. Deshalb weiß Frhr. v. Weizsäcker genau, warum er dem Vertragswerk zustimmt:
„Uns scheint die Zustimmung auch deshalb geboten, weil nur andere, Dritte, davon profitieren, solange die Angelegenheiten zwischen Polen und Deutschen unerledigt bleiben.“
Die Sorgen des Kleinen Mannes
Wenn nun also die BRD profitiert, da inzwischen die Angelegenheiten zwischen Polen und Deutschen erledigt sind, so heißt das nicht, daß der Nutzen der Polenverträge dem deutschen Volk zugute kommt. Das beweist das Parlament schon dadurch, daß es von den Sorgen der Bürger –
„Ich bin gegen die Polenverträge, aber man kann ja nichts gegen die Annahme machen. Mich ärgert, daß wir soviel Geld an die Polen zahlen müssen und dann kommen noch viele zu uns, wo wir doch hier schon Arbeitslose genug haben. Das muß alles der kleine Mann tragen.“ So Frieda Kriechbäum (60), Hausfrau, in der AZ (13./14.3.1976),
– keine Notiz nimmt, es sei denn, um sie ihnen auszutreiben. Mit vereinten Kräften agitieren Regierung und Opposition die Bürger für die Abstraktion von ihren Interessen.
Filbinger, der Rückreiseprämien für Gastarbeiter vorschlägt, beschimpft die „Sorge“:
„Ja, wie sollen wir jetzt in dieser Krise, wo wir große Arbeitslosigkeit haben, auch noch mit denen fertigwerden, die etwa kommen?“
als „kleinmütig“, die gefälligst „völlig in den Hintergrund zu treten“ habe, weil die Einschränkungen, die die Bürger heute für ihre Brüder aus Polen auf sich nehmen sollen, gar nichts gegen die Opfer sind, die das deutsche Volk früher schon bereitwillig gebracht hat:
„12 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge hat das deutsche Volk aufgenommen, ihnen das Dach über dem Kopf, Arbeitsplatze, wirtschaftliche und gesellschaftliche Integration in den deutschen Volkskörper gegeben.“
Koschnick, als Mensch und Vater, wird persönlich und appelliert an alle Eltern, ihren Kindern zuliebe, die nichts dafür können, die Versöhnung mit Polen über ihre Interessen zu stellen:
„Ich möchte – das sage ich in aller Offenheit – gern erreichen, daß mein jetzt 18jähriger Sohn nicht mehr mit den gleichen Belastungen in Europa leben muß wie wir.“
Willy Brandt beschwört eindringlich den deutschen Versöhnungswillen: „Es ist gut, daß bei allen Sorgen, die wir haben, in unserem Volk das Engagement und die Hingabe für das Werk der Versöhnung zwischen dem deutschen und dem polnischen Volk lebendig ist.“ denn nicht als Arbeitender soll der Bürger das Für und Wider dieser Verträge abwägen, sondern als Staatsbürger, und folglich sollen ihm die Aussiedler auch nicht wie Konkurrenten, sondern wie verlorene Söhne vorkommen, die heimzuholen die Menschlichkeit gebietet. Wer wäre davon nicht zu Tränen gerührt: „Schon wird in den Briefen, in denen diese Menschen die bange Frage nach dem Zustandekommen der Verträge stellen, die Verzweiflung hörbar, die ein Scheitern auslösen würde.“ (Genscher) |
 |
Und Wehner weiß, wie er die persönlichen Erlebnisse des Herrn Beermann anbringen muß, um in jedem deutschen Soldaten die Erinnerung an die deutsche Kriegsschuld wachzurufen:
Er schildert die Gefühle seines Freundes, „der am 1. September 1939 im Dienst über die Grenze nach Polen marschiert ist, bei der Begegnung mit dem ersten Gefallenen auf der Gegenseite — Polen — und wie ihn das verfolgt hat.“, weil jeder diese Gefühle 1976 wieder haben soll.
Der Friedenswilly macht das gleiche allgemeiner, aber nicht weniger wirkungsvoll:
,,Ich erspare (?) es mir, die Statistik des Grauens vorzutragen, die aufzustellen war, als unser polnisches Nachbarvolk Besetzung und Krieg hinter sieh hatte. Wir alle kennen diese Statistik , und wissen, daß hinter jeder Zahl geschundene, gequälte, gefolterte, getötete Menschen stehen...Denn wo war neben dem millionenfachen Mord an den Juden Schlimmeres geschehen?“
Mit allem Pathos, das er aufzubringen vermag – „ich sage mit allem Bedacht und mit Respekt vor den vielen einzelnen in unserem deutschen Volk und wende mich dabei an alle Bürgerinnen und Bürger in unserer Bundesrepublik“ – beteuert er:
„Es ist mein sehnlichster Wunsch, daß die Deutschen sich im Streben nach Versöhnung zusammenfinden mögen.“
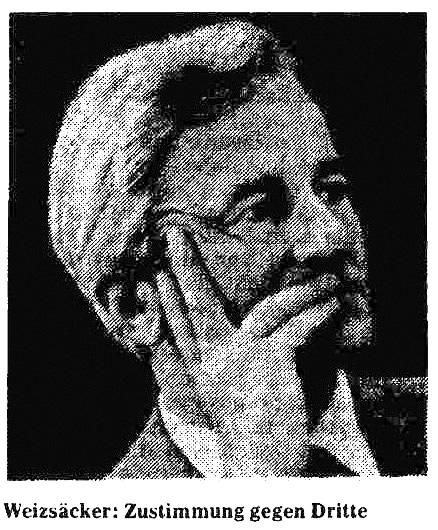 |
Die Opposition nun stört an der Politik der Regierung nicht, daß sie auf Kosten der Bürger geht, weshalb sie sich auch mit der Regierung einig weiß. Ihr Problem dabei ist: der Eindruck muß zerstört werden, daß es zur Politik der Regierung keine Alternative gibt: „Wir sind nicht der Meinung, daß wir, weil wir für eine Aussöhnung, einen Ausgleich und eine Verständigung mit Polen sind, unbesehen die Argumente annehmen müssen und unbesehen den Texten zustimmen müssen, die Regierung und Regierungskoalition uns hier vorlegen.“ (Carstens) In ihren Entgegnungen gegen die Regierung zeigt die Opposition denn auch, daß man vom Willen zur Versöhnung auch anders reden kann und daß sich mit dem Argument, die deutsche Schuld sei gar nicht so groß, sagen läßt, daß man für einen härteren Kurs den polnischen Kommunisten gegenüber eintritt: |
„Sie erwecken hier den Eindruck durch alle ihre Redner, als wenn das Leid, das schwere tragische Leid, welches in den vergangenen vierzig Jahren über das polnische Volk gekommen ist, ausschließlich auf deutsche Schuld und deutsche Ursachen zurückgeht. Das ist eben eine falsche, eine verfälschende Darstellung der deutschen Geschichte, gegen die sich die Deutschen mehr und mehr zur Wehr setzen, weil sie es genug haben,(immer von neuem hören zu müssen, daß sie an dem Leid in der Welt und insbesondere an dem Leid des polnischen Volkes die alleinige Schuld trifft.“ (Carstens)
Wer macht die bessere deutsche Politik?
Das moralische Geseiche von der deutschen Schuld oder Nicht-Schuld zeigt, daß Regierung und Opposition nur ein Problem haben: nämlich ihre Politik als von allen gewollte Durchsetzung des Staatsnutzens vor der Öffentlichkeit zu legitimieren. Weil es die Gleichung von Bürgerwohl und Staatsnutzen nicht gibt, also auch der Staatsnutzen nur als Alternative staatlichen Handelns existiert, streiten sich die Parteien im Bundestag gegenseitig die Berechtigung ab, die Übereinstimmung der Bürger mit ihrer Politik in Anspruch zu nehmen. Alle Argumente, mit denen sich die Parteien konfrontieren, haben nur einen Inhalt: die andere Partei macht schlechte Politik, die eigene dagegen setzt die deutschen Interessen besser durch. Weil die Opposition eine Außenpolitik der Stärke vertritt, sieht sie in den Polenverträgen die Interessen des deutschen Volkes ungenügend gewahrt:
„In der vorliegenden Form tragen die Vereinbarungen weder den humanitären Erfordernissen noch den deutschen Interessen in befriedigender Weise Rechnung.“ (Erklärung der CDU/CSU)
Im Fall der Polenverträge läßt sich sogar noch in Heimkehrer-Zahlen ausdrücken, welche Politik die bessere ist. Die Opposition fordert im Namen der Versöhnung gleich alle 280 000, und handelt sich deshalb seitens der Regierung, die sich mit 125 000 zufriedengibt, den Vorwurf ein:
„Einerseits betonen Sie das vorrangige humanitäre Interesse ... andererseits sind Sie bereit, in Kauf zu nehmen, daß beim Scheitern dieser Verträge so bald nicht einmal diese 120 000 bis 125 000 ausreisen können.“ (Schmidt)
– denn 125 000 ist besser als nichts.
Für diejenigen, die noch immer nicht gemerkt haben, daß es der Politik der „Versöhnung und Menschlichkeit“ nicht um die Menschen geht, haben die Politiker den Staatsnutzen nicht nur in der Maßeinheit von deutschstämmigen Polaken, sondern auch als saubere Kosten-Nutzen-Kalkulation berechnet: bei 1,3 Millionen Rentenpauschale erscheinen die Polen natürlich etwas hoch veranschlagt, was die Bundesregierung dazu veranlaßt, zu versichern, daß dabei noch gespart worden sei gegenüber dem, was sonst auf uns zugekommen wäre — als könnte der polnische Staat das Geld ohne die Bonner Zustimmung eintreiben! Die Opposition dagegen hält die Rentenpauschale nicht für zu hoch, sondern für von der Regierung mutwillig verschenktes Geld, denn früher waren Polen auch umsonst zu haben:
„Als die CDU/CSU dieses Land regiert hat, sind von 1956 bis 1969 400 000 Deutsche raus den ehemaligen Ostprovinzen gekommen, ohne daß man dafür eine Gegenleistung gezahlt hätte. Das, meine Damen und Herren, war deutsche (!) Politik.“ (Jaeger)
Zwar kann die Opposition damit auch keine bessere Polenpolitik machen, aber die Erinnerung an frühere Leistungen ist doch sehr werbewirksam.
Jede Seite betont also, daß sie es besser macht, denn ihre Politik ist deutsche Politik, nur sie setzt den Staatsnutzen durch.
Da der Polenvertrag dabei nur als Material dient, sich selbst als die bessere Alternative darzustellen, lassen sich auch die unterschiedlichen Einschätzungen des Vertrages selbst in einem Satz zusammenfassen: „Reduziert man die Kontroverse auf ihren Kern, so stand auf der einen Seite die Befürchtung der Opposition, daß keine hinreichende Garantie für die Erfüllung der polnischen Zusage gegeben sei und der Vorwurf, sich eine Offenhaltungsklausel nicht schriftlich gesichert zu haben sowie überhaupt in den Verhandlungen mit Polen nicht fest genug gewesen zu sein. Dem gegenüber betonte die Koalition, das Optimum des Möglichen herausgeholt zu haben...“ (Einleitung zur Polendebatte in: Das Parlament) Kurz: Ist der Nutzen des Vertrags groß genug? |
 |
Das, was sich um diesen Kern herum abgespielt hat, „leidenschaftliche Auseinandersetzungen, ins einzelne gehende Zusammenstöße der Spitzenpolitiker“, ist aber keineswegs überflüssig, sondern gehört wiederum zum Kern der Sache: ..Die Debatte konnte nicht sachlich bleiben. Es lag am Thema.“ (Bericht aus Bonn — Nowottny) Denn im Licht der Öffentlichkeit kommt es darauf an, dieses Thema so zu debattieren, daß man sich ins rechte Licht setzt, auf die andere Partei dagegen das öffentliche Mißfallen lenkt. Aus der Unzufriedenheit der Bürger, die die Staatsgeschäfte begleitet, versucht jede Partei, Kapital zu schlagen : die anderen sind schuld, allein ihrer fehlerhaften Politik verdanken sich die Mängel, über die der Bürger zu Recht klagt.
Die eigene Linie dagegen entspricht den Interessen der Allgemeinheit. Die Bekenntnisse zum gemeinsamen Ziel bilden daher nur den Auftakt zum Angriff auf den Gegner, daß er dieses Ziel schlecht, nur vorgeblich oder überhaupt nicht verfolge, um ihm schließlich die Eignung für die Staatsführung überhaupt abzusprechen oder seine charakterlichen Qualitäten zu diffamieren.
Der politisch-moralische Gesamtzusammenhang
Angesichts der Tatsache, daß die Transaktion mit Polen Geld kostet, reicht der einfache Vorwurf der Verschwendung von Steuergeldern nicht aus. Man versichert vorweg, daß man es nicht so primitiv meint:
„Es geht doch uns nicht ums Geld. Es geht um den politisch-moralischen Gesamtzusammenhang,“
um dann die Beunruhigung des Steuerzahlers über die „Begehrlichkeit“ (Carstens) der Hungerleiderkommunisten im Ostblock erst richtig aufzustacheln:
„Es geht uns, der CDU, darum, daß diese Verträge mit ihren Doppeldeutigkeiten, diese Verträge, die auf grundlegende Rechtspositionen Deutschlands einen Nebel gelegt haben, nicht dazu führen, daß wir immer neu im Namen der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts zur Kasse gebeten werden.“ (Mertens)
Von der Geldfrage ergibt sich ein zwangloser Übergang zu dessen Nichtvorhandensein aufgrund der allgemeinen Mißwirtschaft der Regierung. Eine Erinnerung an die Zerrüttung der Staatsfinanzen ist nie fehl am Platz:
„Sie können die Renten sowieso schon nicht bezahlen.“ (Sick)
und überhaupt:
„Es wird sich herausstellen, ob wir vor der Geschichte das gleiche sagen können wie Ihre Vorgänger als deutsche Bundeskanzler: daß wir von unserem Vorgänger ein geordnetes Gemein- und Staatswesen übernommen haben.“ (Kohl)
 |
Von den Polenverträgen kommt man ohne weiteres zur Ostpolitik insgesamt, eine „Politik des Nachgebens und Aufgebens“, um der Regierung vorzuhalten, was alles, außer dem Ausverkauf deutscher Interessen ans Ausland, sie nicht erreicht hat: „Dem Verzicht auf ein Viertel des deutschen Staatsgebiets folgen 3,25 Milliarden mehr oder weniger gute Deutsche Mark. Und nun erwarten Sie, daß wir zu der gescheiterten Regierungs- und Ostpolitik ja sagen. Der Bundesregierung soll offenbar durch uns (!) das Geld für die Folgen einer falschen und dilettantischen Politik beschafft werden. Dieses Geld müssen Sie sich selbst bewilligen und sich dabei vielleicht die Frage vorlegen, wie es eigentlich um die 270 Milliarden steht, auf die das private Vermögen der Vertriebenen im Osten geschätzt wird.“ (Jaeger) Die Opposition hat aber auch keine Idee, wie man an die 270 Milliarden rankommen könnte und beklagt daher lieber, was den Deutschen sonst noch alles durch die Verträge flöten geht. Alles, was nicht drinsteht, verschenkt die Regierung: „Sie finden nicht ein Wort über die Deutschen, die in diesen Gebieten leben, nicht ein Wort über Familienzusammenführung, nicht ein Wort über menschliche Erleichterungen, nicht ein Wort über Volksgruppenrechte und Minderheitenschutzrechte.“ „Für Volkstum, Sprache und Kultur ist in diesen Verträgen nichts getan. Vom Recht auf Heimat reden wir schon gar nicht.“ (Jaeger) Die Regierung befreit weder die Ostgebiete noch die Polen: „Durch die Anerkennung eines totalitären Regimes wird die tiefere Interessenlage des polnischen Volkes ins Mark getroffen.“ (Mertens) |
Während die Opposition die Vertriebenen und ihr Vermögen, Deutsche und Polen, Kultur und verlorene Heimat ankarrt, um ihren Vorwurf zu untermauern, daß die Regierung die Interessen der Deutschen sträflich vernachlässigt, fällt es der Regierung umgekehrt nicht schwer, ausgehend von der Tatsache, daß die Opposition gegen die Regierungspolitik ist, nachzuweisen, daß sie gegen alles ist und damit für das deutsche Volk überhaupt nichts leistet.
„Wenn man sich mit Ihren Einlassungen auseinandersetzt, kommt man zu dem Eindruck. letztlich hinter allem doch nur das Nein zu spüren.“ (Schmidt)
Selbst als die CDU regiert hat, hat sie eigentlich nichts getan außer sittlich-theoretische Bekenntnisse vom Stapel gelassen:
„Nur müssen Sie sich einmal fragen, ob Sie die richtige Konsequenz gezogen haben, wenn Sie in den zehn Jahren, die Sie anschließend noch regierten, keine Möglichkeit sahen, aus dem theoretisch-sittlichen Bekenntnis tatsächliches politisches Handeln zu machen.“ (Schmidt)
Die CDU will „sich aus der politischen Verantwortung herausmogeln“ (Koschnick), möchte die bedauernswerte Regierungskoalition schuften lassen, um sich auf deren Kosten ein faules Neinsager-Leben zu machen:
„Jeder kann dann fröhlich sein Nein sagen, darauf vertrauend, daß die anderen schon dafür sorgen werden, daß die Versöhnung doch ein Stück konkret vorangebracht werde.“ (Schmidt)
Die Opposition, deren einzige Anstrengung darin besteht, die Regierung schlecht zu machen, um selbst an die Regierung zu kommen, will dies gar nicht und Mischnick weiß auch warum: sie weiß nicht, was sie dort machen sollte.
„Wenn Sie darüber lachen, zeigt das ja, daß Sie nicht in der Lage sind, sachlich zu antworten, und daß Sie sich der Notwendigkeit der sachlichen Antwort entziehen wollen. Sie wissen keine Alternative, das ist doch der Punkt.“
Der Vorwurf, keine konstruktive Alternative zu bieten, läßt sich noch steigern: wer sich nicht für den Staat (d. h. für die Politik der Regierung) einsetzt, der arbeitet gegen ihn. Koschnick plagt „eine tiefe und bedrückende Sorge. Die Beiträge der CDU enthalten ein ausgesprochen, destruktives Element.“ Sie verärgert den Vertragspartner und die westliche Welt: „Das wird draußen bei den Partnern Wirkungen haben.“ (Wehner), treibt die „Bundesrepublik in eine außenpolitische Sackgasse und vergiftet da innenpolitische Klima“ (Mischnick). Mit „demagogischen Aufwallungen“ verhetzt sie die Bürger, untergräbt das Vertrauen in die Regierung, ohne daß sie ihnen etwas Besseres zu bieten hätte, wie man ja weiß.
So sehen wir diese unsere Verantwortung
Einträchtig benützen Regierung und Opposition die Debatte um die Polenverträge als Vorwand, um ganz unabhängig von dem, was zur Entscheidung steht, die Staatstreue der Gegenseite zu bezweifeln. Man läßt sich Gott und die Welt einfallen, um den Schaden vorzuführen, den die andere Partei dem Staat und seinen Bürgern zufügt, sodaß die Angegriffenen Rechtfertigungsversuche ganz besonderer Art starten: jeder beschwört, daß er ganz im Dienste am Wohl der Bevölkerung aufgeht, und demonstriert dies, nicht an den Taten, an denen das Volk ja wohl selbst feststellen kann, ob sie sein Wohl fördern, sondern in der Enthüllung der eigenen Gewissensarbeit. Alle beteuern gegenüber der Öffentlichkeit, daß sie unter der Verantwortung ächzen, sich erst nach penibelster Gewissensprüfung zu ihrer Entscheidung durchringen und dann entschlossen zu dieser stehen, als ob dies die Qualität ihrer Politik erst ins richtige Licht rücken würde.
„Der Bundeskanzler und ich haben in jener Nacht in Helsinki redlich geprüft, ob unser Ja zu verantworten ist, und ich bekenne Ihnen hier als unsere Überzeugung...“(Genscher)
Kanzler Schmidt hat auch gerungen:
„Das war in der Tat eine äußerste Anstrengung. Das war in der Tat eine äußerste Anstrengung. Nur: das war eine äußerste Anstrengung, wie man sie nicht wiederholen kann.“ (Flappmann Kohl mit seiner Herzverfettung schon gleich gar nicht.)
Albrecht läßt der Öffentlichkeit durch seine Frau, „mit der er daheim im Dorf Ilten bei Hannover das Doppelbett aus Messing teilt,“ mitteilen, er habe „wirklich nächtelang nicht schlafen können (Kunststück – in einem Messingbett) – aber ausschließlich der Frage wegen: Wie wirst du diesen Hunderttausenden von Deutschen in Polen gerecht?“ (Spiegel 11)
Die Volksvertreter, denen die Forderung nach konjunkturgerechten Tarifabschlüssen z. B. ohne große Gewissensnöte über die Lippen geht, die sich keineswegs mit der Frage die Nächte um die Ohren schlagen, ob sie es verantworten können, den Hunderttausenden von Deutschen, die sich hierzulande als Arbeiter ernähren, zu empfehlen, ihre Bedürfnisse dem Aufschwung zu opfern und sich zum Wohle der Gemeinschaft ausbeuten zu lassen, berichten ohne jede Scham von den seelischen Qualen, die ihnen die Verantwortung der Entscheidungsfindung angeblich bereitet. Wer solche Lasten trägt, kann Respekt fordern:
„Ich nehme für mein wohldurchdachtes und verantwortungsbewußt begründetes Nein denselben Respekt hinsichtlich meiner menschlichen Motivation in Anspruch.“ (Mertens)
und sich leidenschaftlich der moralischen Pflicht hingeben, zu der man seine Politik erklärt hat:
„Ich nehme daraus auch die moralische Pflicht, leidenschaftlich dafür zu plädieren, daß deutschen Mitbürgern die Chance eröffnet wird, zurückzukehren.“ (Kohl)
Das, was sie tun, tun sie mit Entschiedenheit, was eine ganz besondere Leistung ist, auch wenn es sich nur um's Jasagen dreht:
„Wir sagen ein klares Ja zum Auf und Ab!“ (Kohl)
„Ich sage Ihnen — und zwar nicht nur für meine Person — dies gilt auch für Herrn Genscher und die Freie Demokratische Fraktion: wir sind mit dem Herzen und mit dem Hirn, ganz und gar, bei dieser Sache!“ (Schmidt)
Parteitaktische Vorteile und keine Grundsatzfragen deutscher Politik
Alle beweihräuchern die eigene Verantwortlichkeit unabhängig von dem, was sie zu verantworten haben, um die Gegenseite als unverantwortlich hinzustellen. Im Gegensatz zur eigenen Aufopferung im Dienste der Allgemeinheit verfolgen CDU/CSU resp. FDP/SPD ihr Parteiinteresse, versuchen bloß, dieses als das der Bürger zu behaupten, weshalb man sich wechselseitig entlarven muß und damit vorführt, daß es wirklich keiner der Parteien um den Bürger geht.
Besonders eindrucksvoll ist der Nachweis, daß die Konkurrenzpartei über das Richtige und Notwendige in der Politik durchaus Bescheid weiß – was natürlich mit der Zustimmung zur eigenen Linie in eins fällt –, aber leider dieses bessere Wissen ihren kurzsichtigen parteipolitischen Zielen opfert. Jaeger von der CSU will gar nicht „weiter zurückgehen und den Regierenden Bürgermeister an sein Wort „Verzicht ist Verrat“ erinnern.“ Schmidt sorgt sich um das Erinnerungsvermögen von Carstens:
„Herr Abgeordneter Carstens, Sie sind lange genug im auswärtigen Dienst gewesen, um zu wissen, daß zu der Zeit, wo Sie als hoher Beamter entscheidende Verantwortung in jenem Amte trugen, unter einer CDU/CSU geführten Regierung ein Gesetz hier im Hause verabschiedet wurde...Mir kommt es nur darauf an, daß jemand, der wie Sie eine lange Tätigkeit in solchen Ämtern hinter sich hat, sich bei alldem, was er heute ausführt, bitte dessen bewußt bleiben möge, was er früher getan und was er früher ausgeführt hat.“ (Schmidt)
Kohl kann das auch:
„Herr Bundeskanzler, ich las neulich eine Bemerkung von Ihnen, die ich ganz richtig fand. Warum sagen Sie das aber nicht auch hier, warum sagen Sie hier das genaue Gegenteil?“
Anschließend geht es an die Enthüllung des Parteiinteresses. Wo vorher alles von Verantwortlichkeit triefte, zeigen sich jetzt die niederen Triebe, der blanke Parteienegoismus, dem natürlich das Wohl des Staates, dem sich die jeweils andere Partei verschrieben hat, zum Opfer fällt. Die SPD manipuliert die Staatsinstitutionen zu ihren Gunsten:
„Hier zeigt sich doch, daß die Sozialdemokraten dann, wenn sie in der Opposition sind, die Rechte des Bundesrates ausweiten wollen, wenn sie aber in der Regierung sind, wollen sie ihm nicht einmal die Rechte lassen, die er wirklich hat. Aber, meine Damen und Herren, genau das wollen wir nicht. Der Herr Kollege Friedrichs verwechselt hier die Bundesregierung mit der Bundesrepublik, den Staat und die Sozialdemokratische Partei!“ (Jaeger)
Die Retourkutsche maskiert die Denunzierung des Gegners als Verständnis für dessen Probleme: „Verzeihung. Ich werfe niemandem vor, daß er versucht, ein solches Vehikel zu benützen, wenn er meint, parteitaktische Vorteile daraus zu ziehen. Nur sollte er dann auch sagen, daß es parteitaktische Vorteile sind und keine Grundsatzfragen deutscher Politik!“ (Koschnick) Kanzler Schmidt kennt nur das Interesse des Staates, so daß er die Opposition anfleht, die ihr zukommende kritische Funktion zum Nutzen des Staates (der Politik, die er macht) auszuüben, anstatt sie für Parteizwecke zu instrumentalisieren: „Die Kritik stört ja auch gar nicht, im Gegenteil: an vielen Stellen — ich sage das ganz offen, es überrascht Sie hoffentlich nicht — ist doch Ihre Kritik auch erwünscht! Aber die Kritik kann doch nicht zu anderen Zwecken dienen als dazu, daß die Position des eigenen Staates „(ätsch, nicht konstruktiv)“ gestützt und gestärkt wird. Kritik kann doch nicht zum Beispiel zu dem Zweck mißbraucht werden, daß sie als Instrument dienend eine schwierig zusammenzuhaltende Gemeinschaft von Parteien besser zusammenzuhalten helfen soll. Die Außenpolitik darf doch nicht zum Instrument innenpolitischer Auseinandersetzungen und Taktik gemacht werden!“ (Schmidt) So bezichtigt man sich wechselweise dessen, was jeder selber tut. Während die Regierungskoalition sich alle Mühe gibt, sich als einzig mögliche Alternative anzupreisen, um Regierung zu bleiben — sie beansprucht für sich die ganze staatsmännische Verantwortung und beschimpft die Opposition, ihr ginge es bloß darum, an die Macht zu kommen — betreibt die Opposition das gleiche Spiel mit vertauschten Rollen. |
 |
Jede Partei führt sich als Staat auf, der alles für seine Bürger tut und dem die andere Partei nur Schaden zufügt. Da also jede Partei das gleiche von sich behauptet, behauptet es die andere zu Unrecht: sie betrügt die Öffentlichkeit.
Gestehen Sie doch endlich!
Die Versöhnungspolitik der SPD arbeitet mit „halben Wahrheiten“ und vertritt eine „falsche und verfälschende Darstellung der Geschichte“ (Carstens), die dem deutschen Volk die ganze Schuld in die Schuhe schiebt. Carstens will aber natürlich keine Aufklärungskampagne ins Leben rufen, der Schrei nach historischer Wahrheit ist nur die Einleitung für die Diffamierung der SPD-Politik, die den Ansprüchen der CDU nicht genügt. Erstens gibt sich die SPD bloß den Anstrich der Menschlichkeit — im Gegensatz zur CDU, die ja, wie man weiß, vor lauter Menschlichkeit nicht schlafen kann — und zweitens, und das ist das Schlimmste, behauptet sie auch noch, daß die Polensache ein gutes Geschäft wäre:
„Aber meine Herren von der Regierungskoalition, räumen Sie doch endlich ein, gestehen Sie doch endlich, daß Ihnen alle diese Überlegungen, die wir hier anstellen, gleichgültig sind, daß es Ihnen gleichgültig ist, ob die Menschen eine höhere Rente bekommen oder nicht. Es kommt Ihnen darauf an, einen Grund zu finden, 1.3 Milliarden an den polnischen Staat zu zahlen. Nun, meine Damen und Herren, machen Sie eine ungeheuerliche Sache: Sie versuchen, die gleiche Leistung, die Sie der polnischen Regierung als ein großes Opfer darstellen, in unserem Lande dadurch schmackhaft zu machen, daß Sie den Eindruck erwecken, als ob wir Deutschen damit ein großes Geschäft machten.“ (Carstens)
Aber die CDU ist auch nicht aufrichtig. Sie betrügt die Deutschen um ihre Versöhnung:
„Glauben Sie, Herr Professor Carstens, daß solche Töne der für einen großen Teil Ihrer Fraktion glaubwürdig gemachten Ernsthaftigkeit Ihres Versöhnungswillens entsprechen und daß sie der Versöhnung irgendwie nützen könnten?“ (Schmidt)
Mit einer „verzerrten Darstellung“ hat die Opposition dem deutschen Volk verheimlicht, um was es geht. Deshalb geht es, wenn die SPD um Zustimmung für ihre Politik kämpft, auch um die Wahrheit:
„Unser Volk muß wissen, was auf dem Spiel steht, und warum wir deutschen Sozialdemokraten mit aller Kraft, über die wir verfügen, gegen eine solche Fehlentwicklung ankämpfen.“ (Brandt)
Man appelliert an die Gegenseite, nichts zu verschweigen, Ehrlichkeit walten zu lassen, volle Rechenschaft abzulegen usw. usw. Es stellt also eine eigene Leistung dar, sich zur eigenen Politik zu bekennen. Mit ihrer wechselseitigen Aufforderung zur Aufrichtigkeit bringen die Volksvertreter zum Vorschein, daß sie in der Vollführung ihres Geschäfts den Interessen derjenigen, die sie vertreten, zuwiderhandeln und daher nicht auf deren Einverständnis rechnen können. Und das allein ist ihre Sorge. In ihren Anstrengungen, die Wähler auf ihre Seite zu bringen, gehen sie daher ganz ab von der Darstellung der Differenzen ihrer Politik und betreiben Werbung in übelster Weise: indem sie sich wechselseitig die erforderliche Verantwortlichkeit absprechen und die Aufrichtigkeit gegenüber den Wählern in Frage stellen, beschränken sie sich darauf, ihre Vertrauenswürdigkeit als Staatsmänner herauszustreichen. Daher lassen sie sich auch nicht von moralischen Skrupeln plagen, wenn es darum geht, die Vertreter der anderen Partei schlecht zu machen und mit den miesesten Tricks den Beifall der Öffentlichkeit zu ergattern. Der Wettbewerb zwischen den Parteien wird ausgeführt als Wettbewerb von Figuren, bei dem es darum geht, wer am geschicktesten das Vertrauen der Wähler auf sich zieht.
Der Mensch in der Politik
Deshalb wird die ganze Veranstaltung auch erst dann richtig lebhaft, wenn man die Persönlichkeiten der Konkurrenzpartei als Angriffsziel nimmt und ihre undemokratische Gesinnung oder moralische Zweifelhaftigkeit anprangert. Hier lassen sich denn auch die demokratischen Ideale voll zum Einsatz bringen: Ob man Bekenntnisse zum Parlamentarismus oder zur innerparteilichen Demokratie dazu benützt, dem Gegner eben diese Einstellung abzusprechen und ihn auf diese Weise aus der Solidarität der Demokraten zu entlassen, ob man unter Anrufung der Toleranz Politiker der anderen Partei, weil sie deren Politik vertreten, als intolerant disqualifiziert und sich so der Schwierigkeit entledigt, gegen sie zu argumentieren, oder ob man ausgehend von der Beschwörung der Menschlichkeit in der Politik den Feind zum Unmensch erklärt, der deshalb auch keinen anständigen Umgang verdient – das Herbeten der gemeinsamen Ideale bildet regelmäßig den Auftakt, ein Mitglied der anderen Partei mit einem besonders säuischen Treffer zur Strecke zu bringen.
„Mein Kollege Filbinger“ (der »bezeichnenderweise« (!) schon vor der Bundestagssitzung die Ablehnung der Polenverträge propagierte, ebenso wie die SPD deren Befürwortung) „hält also offenbar den Austausch von Informationen, Meinungen und Argumenten, wie er hier stattfindet, für im Grunde völlig überflüssig ... Das macht schließlich den Parlamentarismus kaputt.“ (Koschnick)
Schon ist er ein Verfassungsfeind. Die SPD nicht minder, denn im sozialdemokratischen Schafspelz steckt die Kaderpartei:
„Aber Herr Bundeskanzler, Sie haben vorher beklagt, daß bei uns der Wille von Strauß exekutiert werde. Dahinter kann ich nur ein Demokratieverständnis entdecken, das die SPD in Niedersachsen offenbar gern durchgesetzt hätte. Jenen unerträglichen Druck von oben, jenen Psychoterror ...“ (Weizsäcker)
Heimliche Leninisten sind natürlich vaterlandslose Gesellen:
„Meine Damen und Herren, das ist eben der Punkt: daß Sie in Ihrer Betrachtung, einer völligen parteipolitischen Verengung jeder Ihrer Perspektiven, zu einem normalen“ (pfälzischen?) „demokratischen Patriotismus gemeinsam mit anderen nur noch sehr schwer fähig sind.“ (Kohl)
Wenn die CDU schon alle Gemeinsamkeit bei sich versammelt, bleibt für die SPD nichts mehr übrig:
„Wenn wir uns das gegenseitig hier nicht mehr konzedieren, Herr Bundeskanzler, ich wende mich vor allen Dingen an Sie, weil Sie in diesen Tagen die Kategorie des unbedingt Richtigen so sehr für sich in Anspruch nehmen, dann wird die Intoleranz in diesem Hause einziehen, die Demokratie lebt davon, daß es einen unfehlbaren Richtigkeitsanspruch in der Politik nicht gibt.“
Pack schlägt sich ...
Weil es also nur um die Durchsetzung des eigenen Interesses geht, für das man die Öffentlichkeit zu vereinnahmen sucht, kann die allgemeine Heuchelei zur direkten persönlichen Diffamierung übergehen. Schmidt kennt keine Pietät gegenüber Kranken und Toten:
„Wenn der Herr Kollege Strauß heute nicht hier ist, weil er in ärztlicher Behandlung ist, ist das eine Sache, die Sie zu respektieren haben. Sie haben im letzten Jahr hier die gleiche Form der Herabsetzung gewählt als ich — und das wußten Sie genau — bei der Beerdigung meines Freundes Karl Schleinzer war! Das ist doch der Punkt, wo ich finde, daß man so nicht miteinander umgehen sollte.“ (Kohl)
Kohl wiederum ist ein Schmierenkomödiant, dem „eine gewisse Begabung für Schaueffekte nicht abzusprechen“ ist (Mischnick), und seine biographischen Auslassungen über seine Herkunft aus einer echten alten Zentrumsfamilie „mit Augenaufschlag“ sind „naiv. Aber es ist natürlich berechnet.“ (Wehner)
Carstens „zerstört uns unseren moralischen Respekt voreinander“ (Schmidt). Schmidt zerstört „um den Preis des Erhalts seiner Macht als Kanzler die menschlichen Brücken, koste es, was es wolle“, tut „alles nur Denkbare, um die Gräben in unserem Lande aufzureißen“ und beschmutzt den Kanzlersessel, den Kohl besteigen will.
„Jetzt frage ich Sie, Herr Bundeskanzler: was soll das, wenn wir beide in einer solchen Form öffentlich verkehren müssen? Glauben Sie wirklich, das trägt zur Reputation des Amtes bei. das Sie bekleiden und für das ich kandidiere?“
Aus folgender schönen Ableitung von Friedensapostel Weizsäcker, der sein Gewissen schon auf dem Tablett vor sich herträgt,
„Die Demokratie wird von Menschen getragen. So wie der menschliche Respekt erst dort wirklich wächst, wo man die Spannungen untereinander aushält (und das ist das Schöne an den Spannungen), so gewinnt auch die Demokratie ihr festes Fundament erst dort, wo wir dasselbe im Verhältnis demokratischer Gegner untereinander lernen.“
kommt raus, daß Kohl der Superdemokrat ist, weil er überhaupt der menschlichste ist:
„Er ist ein Vollblutpolitiker von Jugend auf, aber er ist ein Mensch“ (kein Pferd) „und bleibt das in der Politik. Das ist es gerade, was ihn auszeichnet.“
Weil es also die Politik auszeichnet, daß man sich wie ein Charakterschwein aufführt, geht Weizsäcker daran, dies zu tun, und Schmidt als ein solches zu bezeichnen, weil der „Verdächtigungen lanciert“ und einen „Stil einführt“, der die „Basis im Menschlichen“ erschüttert. Und um dem Ruf nach moralischem Respekt und Vertrauen Genüge zu tun, bezichtigen die sehr verehrten Damen und Herren des Hohen Hauses einmütig abwechselnd die Anwärter auf's Kanzleramt, Schmidt und Kohl, gelogen zu haben (ein Thema, das so ergiebig ist, daß es noch mehrere Pressekonferenzen hinterher ausgewalzt wird), wobei die CDU einen begabten Zwischenrufer, Dr. Stark (!) aus Nürtingen, zum Einsatz bringt, der in Anbetracht seines etwas eintönigen Gedankens zu außerordentlichen Leistungssteigerungen imstande ist:
„Das ist die Art von Teppichhändlern!“
„Das ist nicht richtig!“
„Eine Schmidt'sche Wahrheit!“
Im Duett mit Kohl:
„Dabei arbeiten Sie, Herr Bundeskanzler, mit einem System von Drohungen, Halbwahrheiten und Verleumdungen jeder Art.“
Dr. Stark:
„Und Lügen!“
„Ein unehrlicher, ein unwahrhaftiger Mensch!“
„Der Bundeskanzler sollte sich schämen! Ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit!“
„Auch noch ein Betrüger!“
... und verträgt sich!
Er ruft damit das Präsidium auf den Plan:
„Meine Damen und Herren, während die Frau Kollegin Funcke präsidierte, hat der Herr Kollege Stark in wenig schwäbischer Weise (?) beleidigende Zurufe gemacht. Nach Rücksprache mit der Frau Kollegin Funcke rufe ich den Kollegen zur Ordnung.“
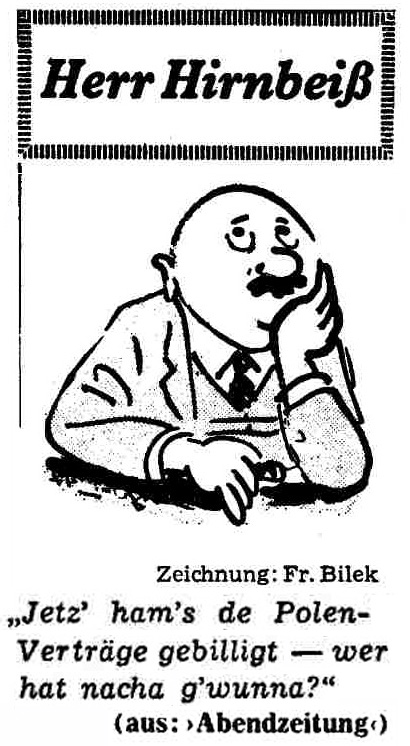 |
Da die harte Arbeit der Parlamentarier darin besteht, sich wechselseitig fertig zu machen, indem man die Unzufriedenheit mit allem, was der Staat seinen Bürgern auferlegt, auf die andere Partei schiebt, endet man konsequenterweise bei einer Diffamierung des Gegners, die ganz unabhängig von der jeweils verhandelten Gesetzesvorlage dessen prinzipielle Untauglichkeit für die demokratischen Ämter und seine moralische Unlauterkeit herausstellt, also nurmehr mit Beleidigungen hantiert. Die eigentliche Könnerschaft des Parlamentsredners besteht darin, die Gemeinheiten, die man loswerden will, einigermaßen an der diskutierten Materie aufzuhängen, so daß sich die Beleidigung geradezu aus der Sache ergibt. Carstens z. B. beklagt sich, daß die Bundesregierung aus den Polen-Verträgen ein „Kampfthema der innenpolitischen Auseinandersetzung“ machen wolle, zitiert Schmidt: ,,Einige werden mich nicht wiedererkennen“, um dann zur Sache zu kommen: „Wir kennen Sie sehr gut. Ich halte Sie jedenfalls für einen sehr intelligenten“ (eine schon etwas anrüchige Qualität) ,,und sehr schnell zupackenden Politiker, der allerdings seine Argumente wählt, wie ihm das gerade in den Kram paßt, ohne Rücksicht auf ihren Wahrheitsgehalt.“ Carstens wird nicht vom Präsidium gerügt, wohl aber der Dr. Stark, der damit sein Stichwort gefunden hat und unermüdlich weiterblökt, daß Schmidt lügt. Auf diese Art „Entgleisungen“, die zur Sache gehören, paßt das Präsidium auf, ruft „zur Ordnung“, „bedauert unparlamentarische Ausdrücke“, um die Glaubwürdigkeit der gesamten Veranstaltung in den Augen der Öffentlichkeit zu retten, eine Anstrengung, die wachsame Politologen und Journalisten unterstützen, indem sie Ermahnungen an die Parlamentarier loslassen, den Stil des Hohen Hauses nicht allzusehr zu vernachlässigen. |
Denn die Wählerschaft könnte ja das Vertrauen in ihre Repräsentanten verlieren, wenn diese sich dermaßen würdelos aufführen. Was diese Art Stilkritiker bewegt, ist die Besorgnis, daß die zuhörenden Bürger an den wechselseitigen Verunglimpfungen entdecken könnten, daß es auch sonst in der allgemeinen Heuchelei, es ginge nur um sie, nicht um ihr Wohl geht, sondern nur darum, unter Berufung auf ihre Interessen oder ihre Mißbilligung der Regierungspolitik, sie dazu zu benützen, den politischen Gegner zur Strecke zu bringen. Deshalb muß Herr Dr. Stark, der nur noch die Schmidt'sche Wahrheitsliebe erörtert, zur Ordnung gerufen werden.
Die Debatte um die Polenverträge geht also gleichzeitig um etwas anderes, es geht darum, der Öffentlichkeit zu zeigen, daß die Politiker der anderen Partei keine ordentlichen Staatsmänner sind, daß es ihnen an Verantwortlichkeit, Aufrichtigkeit und Charakter mangelt, daß der Staat bei ihnen in schlechten Händen liegt. Nun hat zwar die Polendebatte kein einziges Argument dafür gebracht, daß das, was im Interesse des Staates geschieht, den Nutzen seiner Bürger mehrt, wohl aber die Qualitäten seiner Staatsmänner vorgeführt. Um seinen Staat in Ordnung zu halten, braucht das Volk also offensichtlich eben diese Art von Politikern, die keine Skrupel haben bezüglich ihrer Verantwortung und Aufrichtigkeit, und deren Charakterstärke die Charakterlosigkeit ist.
Die Persönlichkeit im Bundestag
Und weil sich die Vertreter der verschiedenen Parteien in Anbetracht dieser Vorzüge in nichts unterscheiden und in ihren Lobeshymnen und Beleidigungen auch nicht nachstehen, führen die Parteien schließlich ihre großen Persönlichkeiten ins Feld.
So dient die parlamentarische Debatte der Selbstdarstellung der Politikerpersonen, bar jeden politischen Inhalts. Reden und Streiten hat nur noch einen Zweck: die Qualitäten des Redners zu unterstreichen. Im Verein mit der wohlstudierten Geste, dem gezielt auf die Person abgestimmten Äußeren (Brille, Frisur, Anzug) soll der Redestil den jeweiligen Politiker ins gewünschte Licht rücken.
Die unterstreichende Gestik verleitet natürlich zur Übertreibung und gibt deshalb häufig den Angriffspunkt ab, um den politischen Gegner lächerlich zu machen. Helmut Kohl etwa, dessen Provinzialität gern verspottet wird –
„Für jemanden, der auf einer Landesbühne steht, ist es gar nicht so leicht, alles schnell zu verstehen, was ... in der Welt vor sich geht.“ (Leber) –
und der das durch würdevolles Mienenspiel auszugleichen versucht, wurde von Herbert Wehner bissig karikiert:
„Was soll denn das, daß man hört – mit Augenaufschlag immer genauso schön halblinks von der Mitte – daß so viele aus alten Zentrumsfamilien kommen?“
Bildregie und Rollenbesetzung
Um die Qualitäten ihrer Spitzenreiter recht zur Geltung zu bringen, wurde ihr Einsatz durch die Regie der Fraktionen geplant, und die weiteren Figuren, über die sie verfügen, funktionsgerecht gesteuert. Die Debatte wurde insgesamt exakt abgestimmt, sodaß der Nachmittag als gute Fernsehzeit sich nicht mehr mit den Ausführungen zum Vertrag selber – das hatte für die Regierung Genscher, für die Opposition Mertes, bereits vormittags erledigt – aufzuhalten brauchte, sondern ganz dem Höhepunkt der Konfrontation zwischen Schmidt und Kohl vorbehalten war. (Mittags, wo der normale Fernsehzuschauer ißt oder ruht, durften die Sachverständigen juristische Probleme des Rentenabkommens verhandeln.)
Die SPD, die das, was gesagt werden mußte, gleichmäßig auf ihre Stars verteilte – der Kanzler verkörpert die Staatsräson, der Friedens-Willy die Ideale, und der Rempler-Wehner übernimmt das Parteiengezänk –, brachte ihren Willy schon am Vormittag zum Einsatz, weil er mit seinem Getöne von Schuld und Sühne für die Verträge selber zu agitieren hatte, Herbert Wehner aber ließ sie am Nachmittag schimpfen und ihn das sagen, was Helmut Schmidt von Amts wegen nicht zu sagen zukam. Helmut Kohl wurde von seiner Fraktion im Anschluß an die Rede des Kanzlers auf's Podium geschickt. Als sein Rivale war er ganz darauf festgelegt, dem Kanzler zu antworten, um sich durch Würde und Vertrauenswürdigkeit kontrastiv zur Schmidt'schen Staatsklugheit in Szene zu setzen. Er durfte aber um der Würde seiner Persönlichkeit willen nicht allzu ausfallend werden, weshalb ihn Dr. Stark in dieser Hinsicht entlastete: in bemerkenswerter Konstanz begleitete er die Schmidt'sche Rede mit den Zwischenrufen „Lügner“, „Heuchler“, „Betrüger“. Eine kleine Einlage: Als Kohl in seiner Rede auf ihn zu sprechen kam, justament da betrat Albrecht den Saal und ließ sich auf der Bundesratsbank nieder. Die Union aber erhob sich wie ein Mann und jubelte dem jungen Aufsteiger zu. Und am Ende der Rede trat der überwältigte Fraktionschef Carstens, vom frenetischen Applaus der CDU/CSU begleitet, auf seinen Kanzlerkandidaten zu und schüttelte ihm die Hände. |
 |
III. Der Nutzen des Parlaments
Diese von den Parteien in Szene gesetzte parlamentarische Dramaturgie wird von aufrechten Demokraten gerne als eine „Entgleisung“ bedauert und vom „Spiegel“ ironisch aufbereitet und goutiert. Durch das Zurschaustellen der Spitzenpolitiker, die mit ihren Mätzchen offen demonstrieren, was Prinzip parlamentarischer Debatten ist – sich gegenseitig nicht ernst zu nehmen –, verkommt, so die Kritik, die demokratische Institution zur Quasselbude, wird „bloße“ parlamentarische Schau.
Die Schreibtische des Kanzlers
Eine derartige Kritik wird praktisch durch die Politiker selbst widerlegt, die wissen, daß so Politik gemacht und nicht etwa verhindert wird. Denn sie sind es, die diese parlamentarische Schau inszenieren und auch mit vollem Herzen dabei sind (darin bewährt sich ihre parlamentarische Würde, für die sie ja bezahlt werden), gerade weil sie sich sicher sind, daß sie im gegenseitigen Sich-fertig-machen ihr Ziel erreichen. Und sie haben selbst auch keine Schwierigkeiten, dieses beim Namen zu nennen:
„Ich hoffe, daß viele Mitbürger in diesem Lande diese letzte Stunde mitgesehen und miterlebt haben. Denn dann. Herr Bundeskanzler, werden diese Mitbürger dafür sorgen, daß wir im Oktober Ihre Schreibtische, von denen Sie gesprochen haben, erben werden.“ (Kohl, Kanzlerkandidat).
Ihre Wiederwahl ist also die einzige Sorge, die die Parlamentarier bewegt; für diesen Zweck setzen sie ihre ganze Kraft ein und gehen beim Bürger agitieren, kaum daß die Wahlen vorbei sind.
Im institutionalisierten staatlichen Agitationsforum, dem Parlament, tragen Regierung und Opposition permanent ihren Kampf aus; jeder Streit, der formell einen Beitrag leistet zur adäquatesten Durchführung des Gemeinwohls, dient der Selbstdarstellung und der wechselseitigen Denunzierung der Parteien vor der Öffentlichkeit. Zugleich aber machen die Diskussionen zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien in ihrem Gerangel um die bestmögliche Regierungsalternative noch immer deutlich. daß Grundlage für das Parteiengezänk die Diskrepanz zwischen Staatsräson und Bürgerwünschen ist; daß der Bürger, auch wenn er an seinem Staat festhält, allen Grund hat, mit ihm unzufrieden zu sein. In einem matten Satz („Wir wissen auch, daß Versöhnung Opfer kostet“) spricht der Bundeskanzler von diesem Problem und verlegt sich ansonsten darauf, sich für die von ihm vertretenen Staatshandlungen zu loben.
Sicherheitsventil Opposition
Die Opposition aber, nach allgemeiner Auffassung ein Kernstück des demokratischen Staates, geht ganz darin auf, im Parlament die Masse der unzufriedenen Bürger staatlich zu vertreten und gegen die Entscheidungen der Regierung geltend zu machen. Daß dem Volk die Ausführung der Staatsgeschäfte nicht zu passen pflegt, weil es seinen Nutzen darin nicht finden kann, wendet die Opposition in „konstruktiver Kritik“ gegen die Regierung, indem sie „beweist“, daß diese mit ihrem Programm und in ihrer personellen Zusammensetzung unfähig ist, das Allgemeinwohl zu exekutieren.
Indem sie die Stimmen der Unzufriedenen an sich bindet und darauf abzielt, die Regierung abzulösen, erfüllt sie ihre Funktion als Opposition, als die im Staatsapparat institutionalisierte Alternative zur Regierung; durch sie erhält der Unmut der Bürger mit den staatlichen Entscheidungen die Form des Angriffs gegen die Regierung als eine Variante staatlicher Politik, die durch eine andere abgelöst werden kann. Weshalb Marx feststellt:
„daß die Opposition in der Regierungsmaschine die gleiche Funktion zu erfüllen hat, wie das Sicherheitsventil in einer Dampfmaschine. Das Sicherheitsventil hemmt den Lauf des Motors nicht, sondern sichert ihn, indem es die Kraft, die sonst die ganze Angelegenheit sprengen würde, als Dampf abläßt.“ (MEW9/74)
Parlamentarismuskritik von Gerstenmaier bis Dutschke
Eine Kritik der Opposition, sie würde die bürgerfeindlichen Untaten der Regierung nicht schonungslos genug aufdecken, fragt nicht nach deren Grundlage im Staat, sondern macht sich im Gegenteil das Anliegen der Opposition zu eigen. Solche Probleme machte sich die APO (die nicht zufällig zur Zeit der großen Koalition zustandekam), wenn sie sich gemeinsam mit dem damaligen Bundestagspräsidenten Gerstenmaier um die schwache parlamentarische Opposition sorgte. Versuchte Gerstenmaier, die Opposition durch eine optische Korrektur (Veränderung der Sitzordnung) zu stärken, so galt der APO der Zustand im Parlament als Indiz dafür, daß der „Formierungsprozeß der Gesellschaft“ abgeschlossen sei und „erstarrte Herrschaftsformen“ die lebendige Demokratie verdrängt haben, weshalb sie eine Zusatzopposition neben der parlamentarischen installierte. Ihr Konzept, auf diese Weise die „pervertierte Demokratie“ zu retten, geriet konsequenterweise in dem Moment in Vergessenheit, wo die parlamentarische Opposition wieder erstarkte und die Diskussion mit der Regierung im Parlament neu belebte. Was die APO wirklich durchsetzte, war eine Parlamentsreform, die zwecks „Aktivierung der Demokratie“ die „Hearings“ schuf ...
Ihren Wunschtraum, man müsse die Bevölkerung durch „massenhafte Aufklärung“, „Dialog mit den in Unmündigkeit gehaltenen Menschen“ (Dutschke) wachrütteln, indem man sie über die unlauteren Machenschaften der Politiker unterrichtet — eine Aufgabe, der sich auch heute noch die Revisionisten mit Hingabe widmen, wenn sie der Öffentlichkeit beizubringen versuchen, das Parlament sei Volksbetrug — widerlegen ihre Adressaten am konsequentesten: Der einfache Mann, der sein Mißtrauen hegt gegen alles, was von „oben“ kommt, weil es ihm selbstverständlich ist, daß Politik ein „schmutziges Geschäft“ sein muß, läßt sich gleichwohl durch derlei Kritik an seinem Staat nicht irre machen bzw. sich davon abhalten, im Wechselspiel von Regierung und Opposition seinen Nutzen garantiert zu sehen. Er hat sich daran gewöhnt, seine Unzufriedenheit mit den Staatsmaßnahmen am Stammtisch auszudiskutieren, um am Wahltag sein Einverständnis mit dem Staat kundzutun, indem er unverbrüchlich an „seiner“ Partei festhält, die für ihn den Staat repräsentiert, oder aber sich der Opposition zuwendet, wenn er meint, daß die Regierung „abgewirtschaftet“ hat, weil zuviele unpopuläre Maßnahmen auf ihr Konto gingen.
Die Parteien, die um diesen Verschleiß-Effekt wissen, nehmen darauf Rücksicht, indem sie dieselbe Politik gegen die Bürger immer wieder von neuen Leuten durchsetzen lassen, wenn sich die alten Typen abgenutzt haben.
aus: MSZ 10 – April 1976