Marburg an der Lahn:
Die bedrohte Idylle
Sittenbild aus einem leicht verrückten Provinzstädtchen
In Marburg – einer als beschaulich gerühmten Mittelstadt – ist von Demokraten das Feuer eröffnet worden: Kommunisten haben sich an der Hochschule festgesetzt und die dort Tätigen derart beeinflußt, daß diese ihrer staatsbürgerlichen Pflicht nurmehr genügen zu können glauben, indem sie bei der letzten Kommunalwahl fünf Kommunisten ein Mandat im Stadtparlament zukommen ließen.
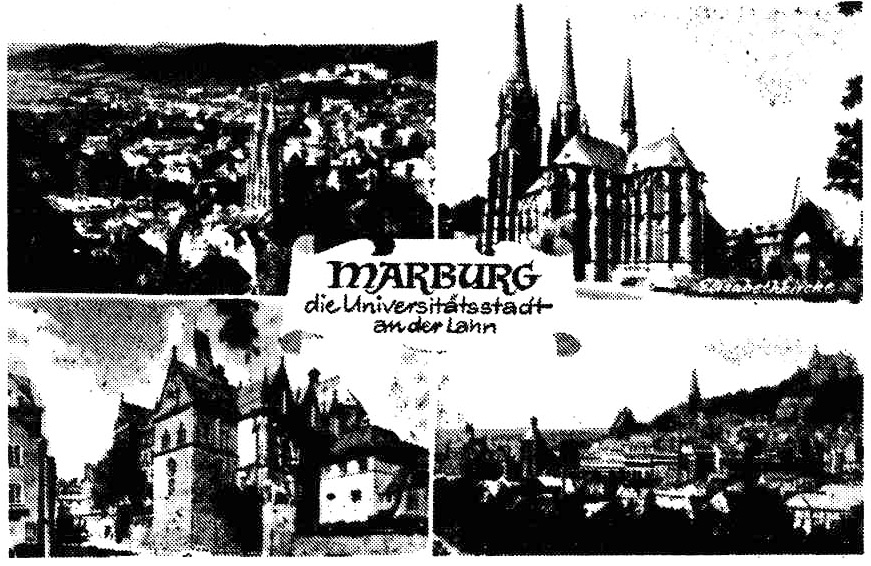
Knapp 2000 universitäre Stimmen konnten indes Marburgs Politiker nicht blenden. Sie gingen zur Tagesordnung über. Als die kommunistische Ratsfraktion das Zünglein an der Waage spielen und „ohne Vorbedingungen eine SPD/FDP-Koalition“ installieren helfen wollte, um so nach der „Macht in Marburg“ zu greifen, nahm die demokratische Entwicklung unaufhaltsam ihren Lauf. Am 15. Mai wählten SPD und CDU ihre Kandidaten wechselseitig in die beiden Bürgermeisterposten und exekutierten so den Wählerwillen gegen die, die ihn dreist für sich reklamierten. Mit diesem Schlag war klargestellt, mit wem Demokraten ihren Staat zu machen gedenken. Jedenfalls nicht mit denen, die „während der Wahl vor dem Gebäude“ mit ihren „Protesten gegen Verfälschung des Wählerwillens“ (UZ) ihrem Gegner einmal mehr demonstrierten, daß sie unter Demokratie etwas anderes verstehen, als er an ihnen praktiziert. Kommunisten, die ausgerechnet dort demokratische Spielregelen nicht gelten lassen, wo sie sie anerkennen – im Rathaus nämlich, in das sie sich haben wählen lassen – entlarven sich damit als Leute, die sich der Demokratie, der sie anhängen, nur beugen wollen, wenn es ihnen opportun erscheint.
Für den demokratischen Staat sind sie solche, die nicht gelernt haben, daß Anerkennung demokratischer Verhältnisse in jedem Falle Unterwerfung unter diese ist. Entsprechend behandelt er sie als Feinde der Demokratie gegen die alle demokratischen Maßnahmen – nicht allein die vergleichsweise freundliche Einsetzung eines Stadtoberhaupts – rechtens sind.
Die Marburger Rathaus-Kommunisten haben indessen anderes im Sinn, als daraus Schlüsse über den Charakter des Rechtstaats und seiner Wähler zu ziehen: angesichts der staatsbürgerkundlichen Demonstration, daß die vom Bürger gewählten Politiker in ihren praktischen Tagesgeschäften dessen Beschränkung durchsetzen, halten sie diesen ausgerechnet „grobe Mißachtung des Wählerwillens“ (UZ) vor und bekunden damit, daß sie von dieser Demokratie, die von ihren Bürgern mit allen ihren Konsequenzen gewollt ist, gar nicht reden. Gegenüber der Konstituierung demokratischer Institutionen durch den Staatsbürger als dessen freiwillige Botmäßigkeit gegenüber der Autorität des Staates operieren sie vielmehr mit der Abstraktion, welch feine Sache diese Freiwilligkeit erst wäre, wenn sie problemlose, nur mehr freudige Identifizierung mit dem Staat sein dürfte, der dann seinerseits ob solcher Verklärung keine anderen Sorgen hätte, als allen wohl und niemand wehe zu tun. Mißmutig im Dunkeln hockend, beklagen sie, der Staat lasse ihnen zu solchen Bekenntnissen zu wenig Raum. Sie halten es für eine „Bedrohung der Bürgerrechte“ (UZ), diese nicht in dem ewigen Lichte erstrahlen lassen zu können, das der kleinsten Hütte Segen verheißt. Diese Sonne der Demokratie, so versichern sie, sollte „eigentlich“ recht wärmend sein, gemessen an dem Schatten den sie unablässig auf ihre Bürger wirft. Nicht genug, daß mit dieser Nörgelei an der Demokratie diese dazu eingeladen wird, solch idealistischem Gelichter mit demokratischen Sanktionen heimzuleuchten: diese Leute beweisen, daß sie sich im Grunde in Verhältnissen ganz wohl fühlen, die ihnen die Möglichkeit einräumen, sich – im Sinne Radio Eriwans – mit der Abstraktion zufrieden zu geben, daß Scheiße ganz schmackhaft sei, wenn man einmal davon absehe, daß sie nicht schmecke.
Während Marburgs Politiker also beweisen, daß zur heilen demokratischen Welt das handfeste Vorgehen gegen Störenfriede gehört, zeigen diese, daß ihnen um eine idyllische Demokratie zu tun ist. Ihr Marburg ist erfüllt von friedfertigen Gerüchten über das, was Demokratie sein könnte, wenn sie es schon nicht ist. Solchen Verrücktheiten ungestört anhängen zudürfen ist ihr ganzer Wunsch. Die Ruhe, die bis dato an der Lahn herrschte, verweist auf das erfolgreiche Arrangement der Kommunisten Marburger Machart mit denen, die in dieser Stadt für Ordnung zu sorgen haben.
So konnten beide Seiten zufrieden sein. Der gute Ruf der Stadt war hergestellt und der Ziehvater der Marburger Linken, W. Abendroth, wußte noch 1965 zu schwärmen:
„Daß … eine interessierte und kritische Minorität nicht zum gemütsfördernden Verbindungsbetrieb, sondern zu diskutanter Erörterung von Problemen gelangt, zeigt die Fülle von wissenschaftlichen und politischen Studentengruppen in Marburg, von der Historiker-Gemeinschaft bis zu mehreren Versionen sozialistischer Studentengruppen. Keine andere Universität hat eine gleiche Vielfalt an studentischen Zirkeln und Studentenzeitungen aufzuweisen … Zudem wird der Marburger Student respektiert: Was für Kurorte der Fremdenverkehr, ist für die Bürgerschaft Marburg die Universität.“
Daß die Bürger ihrer Geringschätzung „kritischen Minoritäten“ gegenüber jahrelang toleranten Ausdruck verliehen, konnte diesen keine Warnung sein, sich auf das dicke Ende einzustellen, das solche Duldung spätestens dann nach sich zieht, wenn den Bürgern und ihrem Staat demokratische Positionen gefährdet erscheinen. Die Narrenfreiheit der linken Kritiker ging jedenfalls nicht soweit, daß Stadtväter ihnen den Schlüssel zum Rathaus ausgehändigt hätten. Die Linke, besorgt um den Ruf, den sie nach dem Krieg mitsamt ihrem Professor Abendroth dadurch erworben hatte, daß sie der Demokratie ihre Ideale vorrechnen durfte, antwortete auf die Praktiken der Staatsmacht mit lautem Geheul. Schließlich müssen sie mit ihrem Renommee auch um all die Bastionen in den Lahnbergen fürchten, von denen aus sie Land und Stadt mir ihren gutgemeinten Kanonaden hatten eindecken dürfen. Dient das Abwehrgeböller der Linken also der Erhaltung der Idylle in der sie sich in Marburg eingerichtet haben, so zeigt dagegen ihr Gegner, wie wenig ihn das alles beeindruckt.
Im Zuge bundesdeutscher Ordnungspolitik. mit der der Staat seine Bürger in die Pflicht nimmt und ihnen vorführt. wie wenig es auf sie ankommt, werden die Positionen auch der Marburger Linken kassiert. An der Universität, ihrer Hochburg, spüren diese längst den frischen Wind, den eine rigorose Anwendung von Ordnungs- und Hausrecht, aus systematischen Überprüfungsverfahren resultierende Nichteinstellungen, bzw. Kündigungen vor allem studentisch wissenschaftlicher Hilfskräfte, gesetzliche Beschneidung der Kompetenzen der Studentenvertretung (Verbot des politischen Mandats) und Androhung rechtsaufsichtlicher Maßnahmen des Uni-Präsidenten gegen linke Politik im AStA entfacht haben (vgl. den Artikel zur probeweisen Einsetzung eines Staatskommissars, in der MSZ 8/75), doch reagieren sie so, als müsse ihr erklärter Gegner Interesse am Status quo linker Seichtbeutelei in Marburg teilen, werfen sie ihm doch vor, daß sein Verhalten „nicht eben dazu beiträgt, Diskussionsbereitschaft und engagierte Interessenvertretung optimal zu fördern.“ (Leitfaden) Wo im hessischen Landtag Erwägungen angestellt werden, wie die Sparmaßnahmen, mit denen eh schon im Bildungsbereich (wie auf anderen Gebieten) den Betroffenen Einschränkungen aufgezwungen werden, am besten gezielt gegen unliebsame Fachbereiche einzusetzen sind, um ihren „Sumpf auszutrocknen“, haben die, die dort sitzen und Kommunisten sein wollen, nichts besseres zu tun, als sich gegen den Angriff der hessischen Demokraten so zu wehren, als gebe es ihn gar nicht: Der Demokratie, die gerade mit ihnen abrechnet, versuchen sie zu beweisen, daß ihre kritische Funktion als Apostel einer besseren Demokratie für sie äußerst bedeutsam wäre.
Wer mit solchen Sprüchen seine Positionen verteidigt, zeigt nicht nur, aufgrund welcher Verdienste sie ihm einmal zugefallen sind, sondern auch, daß er den Kampf um ihre Erhaltung gar nicht intendiert. Anstatt die Pfründe, die Marburgs Universität für sie darstellt, zu nutzen und der Regierung, die sie in die Mangel nimmt, klar zu machen, daß sie mit Widerstand derer zu rechnen hat, die die Einschränkung ihrer Politik auch als solche begreifen, machen sie sich in ihren Fachbereichen und Seminaren daran, dem Ideal aller kritischen Demokraten prinzipieller „Diskussionsbereitschaft“ dadurch freundlichen Ausdruck zu verleihen, daß sie sie unablässig propagieren.
Die zahllosen Aktionswochen, zu denen die Marburger Linke in schöner Regelmäßigkeit aufruft, um zu bekräftigen, daß es sie ungeachtet staatlicher Interventionen noch gibt, gipfeln darum stets in der Aufforderung, an die Verantwortlichen demokratischer Politik oder deren Fürsprecher in der Öffentlichkeit:
„Kommen Sie zu einer Podiumsdiskussion nach Marburg, wenn Sie glauben, ihre Thesen (bzw. Taten) weiterhin aufrechterhalten zu können. Stellen Sie sich ihren dogmatischem Kritikern und legen Sie Rechenschaft ab vor der Marburger Studentenschaft. Wir jedenfalls sind zu einem Streitgespräch bereit. Jederzeit.“ (Marburger Blätter Nr. 4 5 Jg. 26, S. 14)
Die demokratische Bekundung linker Gesprächsbereitschaft soll einen Gegner beeindrucken, der bewiesen hat, daß er auf so etwas pfeift, weil er an dieser Hochschule ja schon die Bereitschaft vermißte zu arbeiten statt zu quasseln. Stellt sich der jeweilige Kontrahent indessen, so besitzt er nur die Unverschämtheit, sein demokratisches Vorgehen vor den Betroffenen zu legitimieren und ihnen diese staatsbürgerliche Vernunft schmackhaft zu machen. Marburgs linke Pracht-Demokraten streichen allerdings nicht nur ihr Interesse heraus, sich so von der Staatsraison auch noch theoretisch vorführen und auf den Sack hauen zu lassen, sie empfinden die größte Lust dabei, den Schlag, diskussionsbereit zu sein, in der Weise gegen sich selbst zu führen, daß sie sich auch noch versichern, wie großartig sie an der Hochschule damit dastehen:
„Dies sind die Voraussetzungen, ohne die eine weitere Demokratisierung der Universität nicht gedeihen kann.“ (Leitfaden)
Anstatt also schlicht das auszusprechen, was zu den staatlichen Repressionen an der Hochschule zu sagen ist, bereitet es ihnen einen Hauptspaß, sich ob ihrer idealistischen Borniertheit auf die Schulter zu klopfen. Marburger Aktionstage bringen also keinesfalls einen Angriff auf den Gegner. Statt dessen steht Selbstbestätigung auf dem Programm.
Unentwegt demonstriert man sich die eigene perverse Einstellung zur Demokratie und feiert darin seine Stärke. Streikresolutionen auf studentischen VV's drücken nicht etwa aus, daß man etwas gegen den staatlichen Ausbildungsbetrieb hat, sondern illustrieren, daß man sich in ihm seine eigene Aktivität beweisen möchte. Ein Streik ist in Marburg daher immer „aktiv“:
„Der aktive Streik geht heute und morgen weiter. In jedem Seminar und jeder Vorlesung muß über die aktuelle Lage der verfaßten Studentenschaft in Marburg diskutiert werden Ziel dieser Seminardiskussionen muß es sein, möglichst viele Kommilitonen zur Verteidigung ihrer verfaßten Organe … zu gewinnen.“ (Streik-Press 1)
Daß es bei der Marburger Streikerei nicht um die Durchsetzung eines politischen Willens geht, sondern darum, überall diskutieren zu lassen, warum es gut wäre, wenn man überall so diskutieren könnte und das immer weiter und darüber Freunde der Diskussion zu gewinnen, zeigen auch die Bilanzen des Erfolgs, die sich unter der Rubrik „Was war los an den Fachbereichen“ vortragen.
„Reges Leben herrschte gestern im Foyer der philosophischen Fakultät. Nach eingehenden Aktionsbeiträgen von Seiten der Fachschaften begannen an verschiedenen Stellen die Aktivitäten zur Durchführung des aktiven Streiktags. Die Fachschaften und politischen Organisationen hatten Büchertische eingerichtet – unter anderem Fachschaft 21 einen Büchertisch, an dem Kuchen und Tee für Solidaritätsspenden für Spanien verkauft wurden. Um 11 Uhr fand ein Sketch der Fachschaft 08/09 Germanistik statt, bei dem unter großem Beifall der Zuschauer in zwei Szenen ein AStA mit und ein AStA ohne politisches Mandat dargestellt wurden. Weiterhin wurde die historische Kontinuität der Disziplinierung (immer schon dagewesen!) der Studenten am Beispiel G. Büchners aufgeführt (dieser Sketch wird heute, 11 Uhr wiederholt!“ (!)
Die Entfaltung zahlloser Formen, mit denen Marburgs schon kindische Linke sich an der Hochschule zur Schau stellt, um Verständnis für sich zu wecken, ergibt alles in allem ein Festival durcheinander schwadronierender Gesinnungsfreunde, die sich in einem einig sind daß sie eine Welt, die ihnen beständig einbläut, was demokratische Tugend ist, durch ostentatives Vorhalten ihres idealistischen Spiegelbilds beschämen müssen. Mit eitlem Wohlgefallen betrachten sie jedes redliche Beieinandersein:
„3000 bei der Studenten-VV … In kämpferischer Stimmung fand gestern im Hörsaalgebäude die größte Studenten-VV in der Geschichte der Marburger Studentenbewegung statt . Die Studenten drängelten sich auf den Gängen. Eindeutig gaben sie ihrem Willen Ausdruck … Verzicht auf das politische Mandat kommt für sie nicht in Frage.“ etc pp.
So harmlos sind in Marburg die politischen Bräuche. Man trifft machtvoll zusammen, sich in seiner guten Gesinnung zu produzieren. Die penetrante Aufdringlichkeit der Linken prägt auch Marburgs Straßenbild. Vor Kaufhäusern, an Haltestellen, in Foyers belämmern sie ihr Publikum mit der obligaten Frage, ob es sich nicht eigentlich auch ein Gewissen aus der Demokratie mache, und insofern bereit sei, mitzufühlen und solidarisch zu sein. Da ein derartiges moralisches Einverständnis auf sichtbare Beweise angewiesen ist, verkaufen Marburgs Sympathiewerber gern rote Fäustchen und sonstige bierzipfelähnliche Insignien, die sie selbst, um sich erkennen zu können, bereits im Knopfloch tragen.
Kein Demonstrationszug in Marburg, bei dem nicht paar- oder gruppenweise schlendernde Teilnehmer lustig ihre Fahnen für die große Familie am Straßenrand wehen lassen, mit dicken Pauken für Stimmung sorgen und so nebenbei den Kinderwagen mitschieben, in dem der stolz präsentierte Nachwuchs der Bewegung ruht. Der Ekelhaftigkeit öffentlicher Onanie nicht genug, intonieren einige besonders abgeschmackte Frohnaturen von Zeit zu Zeit den Refrain:
„Wir lieben unsern Spartakus!“
Der Kampf der Marburger Linken gefällt sich also im Mobilisieren aller Reserven, die eine gekränkte und empörte Moral gegen die staatlichen Anschläge auf ihr Wirken hat. Marburg ist darum der Tummelplatz für Leute, die staatlicher Gewalt mit dem stolzen Selbstgefühl derer begegnen, die glauben, der Schaden, den sie genommen haben und der keinen Bürger hinter dem Ofen hervorholt, beweise irgendjemandem, wie arg es auf der Welt bestellt sei. Die Eitelkeit, sich damit zu trösten, daß es um einen, der viel einzustecken hat, darum schade wäre, ist moralisch. Auf Grund des Schlusses „Viel Feind - viel Ehr“ kommt man dahin, die eigene Sache ex negativo zu legimitieren. Es ist die Ideologie des Opfers, den Sinn seiner beschissenen Lage darin zu sehen, daß diese zu etwas nütze sei: die Nachteile, die einem erwachsen, sind nicht umsonst; sie beweisen, wie recht man in allem hatte. So ist sich Marburgs Linke bewußt, für eine gerechte Sache, für die man viel leiden muß, zu streiten. Der widerliche Triumph dieser Leute besteht darin, immer auf Seiten der Gerechtigkeit zu stehen, deren Notwendigkeit sie aus allem, was ihnen die Demokratie antut, ableiten. Sie brauchen ihr Idealbild einer gerechten Welt wie andere Leute die Luft zum Leben. Ohne dieses Ideal wäre ihre Welt leer, und sie hätten in Marburg nichts zu bejammern.
So jedoch geilen sie sich unentwegt in ihrer Hochburg auf und entwickeln dabei jenen Wirbel, der sie in einer Stadt wie Marburg, die sich zu über einem Viertel aus Studenten rekrutiert, omnipräsent macht. Wie der Flut von Grußadressen und Solidaritätsbekundungen, in die die Linke sich beständig selbst taucht, unschwer zu entnehmen ist. (der Verfassungsschutz ist für diese Hinweise dankbar) sitzen sie in der Tat mancherorts nicht nur auf Lehrstühlen, in Bibliotheken und Vorzimmern, sondern auch in allen erdenklichen Vereinen, Parteien und öffentlichen Einrichtungen der Stadt, vor allem aber in ihren Läden, in denen sie die Utensilien ihrer Bewegung feilbieten, und ihren Wohnheimen und Stammkneipen. Von hieraus knüpfen sie das starke Netz ihrer „Perspektive“, mit dem sie die Stadt überziehen, um niemanden durchschlüpfen zu lassen.
In der Marburger Schule ...
Berühmtestes Beispiel dieser Auffangtätigkeit ist das an der Hochschule etablierte Belabern der Studenten, die Stärke der Linken noch stärker zu machen. Eine hierfür weithin anerkannte „Marburger Schule“, setzte jahrelange Arbeit daran, auf dem, was der Student zu lernen hat, ihren weltanschaulichen Quark breitzutreten, um jedem Studenten seine linke Perspektive zu geben. Wer also nach Marburg geht, weil er gehört hat, daß er dort sein Rüstzeug als Linker erwerben kann, wird sogleich mit moralischem Hallo empfangen, da er von vornherein willens ist,
„sowohl unangemessenen Anforderungen mit kollektiven Forderungen entgegenzutreten, als auch mit längerfristiger Perspektive für bessere soziale Sicherung, Studienform und eine sinnvolle Berufspraxis einzutreten.“ (Leitfaden, D20)
Daß er Probleme mit den „schwierigen Studienbedingungen“ hat, ist nur gut; denn „Betroffenheit“ ist die erfreuliche Grundlage linker Hoffnung, mit der Demokratie doch noch zurecht zu kommen – aber erst die Grundlage. Zwar „ist die Mehrheit der Studenten einem enormen materiellen und psychischen Druck ausgesetzt, lebt in großer Unsicherheit über ihre Perspektive und muß unter schwierigen Ausbildungsbedingungen lernen“, doch bleibt die bange Frage: „Wie reagieren die Studenten auf diese Situation, wie verarbeiten sie ihre Lage?“ (D 11) In Marburg sind deshalb eigens Tutorien eingerichtet, die dazu dienen, bei den Studienanfängern den Keim eines linken Gewissens zu hegen. Hier liegt eine einmalige
„Gelegenheit, die individuelle Betroffenheit der Gruppenmitglieder durch die strukturellen Bedingungen (des Studiums) zu thematisieren und gleichzeitig diese Betroffenheit als interindividuelles Problem aller Gruppenmitglieder erfahrbar zu machen.“ (D26)
Und: „die Tutoren haben in dieser Hinsicht eine wichtige Blicklenkerfunktion.“ (D 6) Damit am Marburger Credo, dem Elend gehöre die Zukunft, kein Zweifel aufkommt, wird an diesem brutalen Anschauungsunterricht explizit die masochistische Gewalt gelobt, die die Gruppenmitglieder zur Gewinnung ihrer Identität als die Betroffenen sich antun müssen, indem sie zur „Bekämpfung zumindest der ärgsten Auswüchse“ ihrer „Verhaltensweisen“ aufgerufen werden. Dieser linke Zynismus
„leistet einen grundlegenden Beitrag dazu, daß die Tuendi kollektive Verarbeitungsweisen herausbilden, die es ihnen erlauben, eine fortschrittliche Zukunftsperspektive zu erarbeiten.“ (D 21)
Der so vorbereitete Student wird nun auf die in Marburg übliche Weise bedient. Ihm wird ein Grundstudium (etabliert am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften) angeboten, in dem er verpflichtet wird,
„die allgemeine Funktionsbestimmung von Ausbildung an einer bürgerlichen Universität in Verbindung mit den politischen Ansprüchen der Beteiligten zu diskutieren.“ (Probleme, S. 4)
... lernt man für ein besseres Leben …
Die Marburger Linke will also die Ausbildung anders verstanden wissen.
„Das bedeutet in diesem Zusammenhang aber zugleich, daß in Ausbildungsprozessen die Befähigungen zu einer demokratischen Berufspraxis als bewußtes gesellschaftliches und politisches Handeln verstanden vermittelt werden.“ (Probleme S. 6)
Der Student muß also die spezifische Marburger Fähigkeit erwerben, die künftige Berufspraxis und damit auch die hierzu erforderliche Qualifikation als etwas zu „verstehen“, was sie so nicht ist. Er bildet sich im Ausbildungsbetrieb nicht einfach für die Gesellschaft; seine „Aneignung und Durchdringung bürgerlich betriebener Wissenschaft“ ist – wie könnte es anders sein „eine kritische“. (ebd.) Der Absolvent der „Marburger Schule“ hat zur gängigen Ausbildung eine Haltung einzustudieren, die ihm erlaubt, sie beständig auf das zu hintertragen, was er an ihrer Stelle gern hätte: eine wahrhaft demokratische Ausbildung, eine echte „Konzeption demokratischer Ausbildungs- und Studienreform.“ (ebd.)
... mit fortschrittlicher Perspektive
In ihrem „gesellschaftswissenschaftlichen Grundstudium“ haben die Marburger Linken der bürgerlichen Ausbildung die Reflexion, wie sie sich zum Wohle der Menschheit gestalten ließe, erfolgreich aufgeherrscht – sie haben es verstanden, sie dieser Perspektive gemäß zurechtzumachen. Die Weigerung der Marburger Links-Ausbilder, das einer Kritik zu unterwerfen, was sich am bürgerlichen Ausbildungswesen störend aufdrängt, ist in diesem Vorgehen beschlossen:
„Dies erfordert nun einerseits eine profunde Kenntnis der in den jeweiligen Berufsfeldern geforderten nichtmarxistischen (bürgerlichen) Theorien und Methoden inclusive derjenigen der empirischen Forschung, andererseits die theoretische und dadurch auch methodische Befähigung zu deren Kritik.“ (Probleme, S. 17)
Um die Destruktion der Kenntnisse bürgerlicher Wissenschaft geht es den Marburgern nicht. Als ausgemacht gilt, daß „diese letztlich nicht aus sich selbst zu kritisieren ist“. (Probleme S. 18) Propagiert wird statt dessen die Kunst, die „einerseits geforderten Ausbildungsinhalte“ der bürgerlichen Gesellschaft mit einem linken „Andererseits“ zu vereinnahmen. Schließlich wäre die in Marburg links betriebene Ausbildung
„mißverstanden, wollte man sie als bloße Parallelität in der Vermittlung von Resultaten marxistischer und nicht-marxistischer (bürgerlicher) Wissenschaft begreifen.“ (Probleme, S. 17)
Wenn die Linken ihre Einvernahme bürgerlicher Ausbildung unter dem wohlklingenden Etikett „Doppelqualifikation“ firmieren lassen, dann zeigt das nur, in welch hermetischem Dauerirrtum sie sich über das halten, was sie tatsächlich betreiben; glauben sie doch, ihre Ausbildung qualifiziere gleichzeitig für die Gesellschaft am besten, gegen die sie sich doch stark machen. Ungeachtet der fühlbaren Beweise, die die Kommunistenjagd an der Hochschule ihnen am eigenen Leib liefert, bestehen die darauf, auch im Sinne einer Gesellschaft ausgebildet zu sein, deren Staat solche Säuberungen veranstaltet, um ihr an der Hochschule ihre Ausbildung zu garantieren.
Die „Doppelqualifikation“ qualifiziert also nicht doppelt, sie qualifiziert durch das in ihr betriebene Vorgehen gegen bürgerliche Wissenschaft einzig dazu, sich ihr gegenüber als Linker zu fühlen. Sie ist in der Tat eine linke „Hochschulung“. Seine Marburger Lektion bekommt der Student in sogenannten „GAK’s“ (Grundarbeitskreisen) erteilt. GAK I ist das Herzstück des ganzen und dient der grundsätzlichen Einschwörung dessen, der schon im Tutorium für seine moralischen Vorurteile gelobt worden war, aufsein Unbehagen an der Wissenschaft. Zur endgültigen Destruktion der Wissenschaft wird erst einmal die bürgerliche gründlich entlarvt. Marburger Kritik stellt sich
„ ... die Frage, wie systematische Gesellschaftstheorie überhaupt möglich ist.“ (Veranstaltungsprogramm S. 2) Die Antwort fällt leicht: man hat lediglich „ … die Resultate bürgerliche Theorie und die Methodik ihrer Aneignung der Wirklichkeit selbst auf die Struktur bürgerlicher Gesellschaf t... zurückzuführen.“ (Probleme 17).
Bürgerliche „Theorieentwürfe“ werden also denunziert, indem man über etwas anderes redet: die Verhältnisse, die nicht so sind, wie sie sein sollen. Kritik bürgerlicher Wissenschaft geht also gar nicht: sie
„ist daher letztlich Kritik bürgerlicher Gesellschaft selbst, bzw. bedarf zu ihrer Entfaltung dieser Kritik.“ (ib.)
„Bewußt gemacht werden soll, daß deren Kenntnis Voraussetzung zur kritischen Reflexion bürgerlicher Wissenschaft bzw. Wissenschaft überhaupt ist.“ (Probleme 19)
Damit ist das Wesentliche schon geleistet. Wer kritisch sein will, muß sich dazu durchringen, die Bedingungen, die ihm dies erst erlauben, kennenzulernen. Anhand eines Exkurses wird ihm
„eine Skizze des Problemzusammenhangs von wissenschaftlicher Erkenntnis und materiellen gesellschaftlichen Verhältnissen“ (ib)
vorgeführt, die ihm noch einmal und nicht zum letztenmal nahelegt, vor aller Kritik seine Position in der gesellschaftlichen Praxis zu bedenken. Vom Schüler der Marburger Wissenschaft ist eine praktische Entscheidung gefordert, die ihn ein für alle mal mit Wissenschaft ins Reine kommen läßt. Welches gesellschaftliche Interesse teilt er? Hält er zu denen, die es gut, oder zu denen, die es schlecht haben? Keine Frage für jemanden, dem diese „Grundstruktur der Anatomie der Gesellschaft“ skizziert worden ist! Und wieder hat man sich eines Freundes moralischer Entrüstung versichert. Doch nicht nur das – zur Wissenschaft steht dieser nun als erklärter Mann des Interesses. Stufe 1 seiner Marburger Ausbildung ist vollendet: er weiß Wissenschaft zu verunmöglichen, indem er sie brutalem Erkenntnisinteresse unterwirft und diese Zerstörung wissenschaftlicher Erkenntnis darf er sich als seinen „Materialismus“ zugute halten.
GAK II baut diesen Standpunkt konsequent aus. Zwei Semester lang wird Marx gelesen, weil er auf das materialistische Interesse anregend wirkt. Er wird dafür gelobt, daß er Sympathien fürs Proletariat gehegt habe. – was im übrigen nicht stimmt – die von ihm in einer interessierten Beschreibung der bürgerlichen Gesellschaft dankenswerter Weise offengelegt worden seien. Der Verfasser des „Kapital“ wird nicht seiner wissenschaftlichen Analyse halber studiert, sondern als Freund der Marburger Szene begrüßt: er erfüllt ihre erkenntnistheoretischen Vorschriften, darf darum zum besten geben, was er „unter dem Aspekt der ökonomischen Strukturanalyse der kapitalistischen Gesellschaftsformation“ (Veranstaltungsprogramm, S. 4) zu erzählen hat.
„Die grundlegende Bedeutung der politischen Ökonomie für die Gesellschaftswissenschaften“, in die sich Marburgs Kommunisten einüben, ergibt sich also „nicht aus sich selbst, sondern vielmehr aus der allgemeinen historisch-materialistischen Einsicht in die bestimmende Rolle des gesellschaftlichen Bereichs der materiellen Produktion und des Austauschs, welcher ihren Gegenstandsbereich bildet, für jede Gesellschaftsformation.“ (Probleme 14)
Da gibt es freilich mannigfache Ungerechtigkeiten auf der Welt: von Klassen, gar von Ausbeutung weiß die Marburger Einsicht zu berichten. So erhält Marx’ politische Ökonomie ihren „wissenschaftlichen(!) Status.“ Als Geschwätz über Klassenkämpfe ist sie willkommen. Klar auch, daß in Marburg
„eine jede Reduktion der Grundlagen der Gesellschaftswissenschaften auf die politische Ökonomie daher abgelehnt werden (muß).“ (ib.)
Geschichten aus dem Klassenkampf
Folgerichtig bietet GAK II im zweiten Teil noch ein marxistisches Potpourri dessen, was sich zum Klassenkampf in unserem Jahrhundert altes feststellen läßt: „Empirisch konstatierbare Phänomene haben … dazu geführt, ausgehend von der Marx'schen Kapitalismusanalyse eine neue Phase in der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft zu konstatieren.“ (Probleme, S. 29) Die Fülle der Tatsachen, die für Marx noch nicht „konstatierbar“ waren, bürdet den Marburgern die angenehme Last auf, nunmehr ein „imperialistisches Stadium“ des Kapitalismus zu konstatieren und überdessen „spezifische Tendenzen“ (Probleme, S. 30) in der Gegenwart zu berichten. Diese Berichterstattung öffnet den Studenten systematisch die Augen darüber, in welch schlechter Welt sie leben, und daß ihre Perspektive darin liegt, fortwährend dagegen anzurennen.
Der ausgebildete Marburg-Kommunist
GAK III schließlich fährt die Ernte dieser Ausbildungsbemühungen in die Scheuer: das „Sozioökonomische System der BRD“ liegt auf dem Tableau der Abrechnung. Nun kann der Student zeigen, was er gelernt hat. Seine antrainierten Ansichten in den Unrechtscharakter der herrschenden Verhältnisse müssen „am empirischen Material nach vollzogen werden“. (Veranstaltungsprogramm S. 7) Mit dieser Probe aufs Exempel liefert der Grund-Student den Beweis, daß er die nötige Sicherheit mitbringt, sich in den Seminaren des darauffolgenden Hauptstudiums den wirklich brennenden Fragen der Zeit zu stellen und sie als selbständig arbeitender Linker zu lösen.
Der fertig ausgebildete Marburg-Kommunist stärkt damit die Position der linken Kräfte an der Hochschule. Aber nur, solange der Staat (der an seiner Wissenschaft Interesse hat) den linken Laden nicht schließt, wird der Marburg-Kommunist dort sein Auskommen finden. Andernfalls findet er sich – für einen bürgerlichen Beruf als untauglich befunden – auf den Straßen Marburgs unter seinesgleichen wieder, wo er dann die gewünschte Gelegenheit hat, seiner linken Qualifikation in der von dorther schon bekannten Weise freien Lauf zu lassen. Die Ausbildung der Marburger Linken disqualifiziert also gezielt für die Reproduktionstätigkeit ihrer Angehörigen und schafft sich auch hier wieder die Opfer staatlicher Disziplinierung. Zugleich produziert sie in diesen das Bewußtsein, sich mit solchen Opfergängen auf dem Boden des Gegners zu dessen Bekämpfung politisch zu qualifizieren. So werden in Marburgs Idylle die Leute verheizt: sie werden befähigt, sich permanent in die Scheiße zu stürzen, die sie brauchen, um zu demonstrieren, wie richtig sie immer in ihr liegen.
Dieser schreckliche Krampf Marburger Politik, ihr wahnwitziger Moralismus, hat indessen neben den Märtyrern, die sie beständig ausschwitzt, ein Abfallprodukt hervorgebracht, das solcher Vaterschaft nicht minder würdig ist – die in solcher Anspannung verschlissenen Moralisten der Marburger Spontiscene. Auch sie zeigen die Male, die ein linkes Gewissen ihnen beständig schlägt. Auch ihre Zier ist Betroffenheit, die sie bewegt, bei Protestaktionen mitzulaufen. Wo indes die engagierte Linke ihre verblendete Politik selbstzerstörerisch gegen sich wendet, da haben die, die solch negative Auswirkungen einer falschen Politik am eigenen Leib verspüren, nicht etwa die Sorge, dieser Erfahrung auf den Grund zu gehen; vielmehr bestehen sie darauf. diese Erfahrung genüßlich festzuhalten und sich in ihr einzurichten. Darüber konstituieren sich Gruppen, wie die WUP (Wissenschaft und Praxis):
„Unsere Legitimation als Gruppe leitet sich nicht aus einem neuen besseren Programm ab, sondern aus unserem negativen Erfahrungsbereich.“
Die Wuppis, die ihre Erfahrungen aus den Fehlern linker Marburger Politik beziehen, bezeugen noch, wie dankbar sie sind. Um zu bekunden, wie tief sie in der Schuld ihres Erzeugers stehen, kritisieren sie ihn nicht, sondern warten darauf, so oft wie nur möglich seiner angesichtig zu werden. Jede Gelegenheit, bei der Marburgs Linke ihre verheerende Politik betreibt, ist ihnen erfreulicher Anlaß, daneben zu stehen und negative Erfahrungen zu machen. Ihr Urteil über Marburger Politik erschöpft sich daher in dem Lamento, heute sei sie wieder einmal besonders schlimm gewesen. Daß diese „Politik stark von moralischen Elementen durchsetzt ist“, (WUP) stört sie nicht ernsthaft; daß sie sich darauf „reduziert“, ist der Umstand, den sie zu beklagen haben. Ihnen mißfällt die extreme Art eines Moralismus, den sie doch selber teilen. Sie haben „Probleme“ damit, daß man in der Marburger Linken „einfach für mehr Bafög sein muß“ (WUP) – nicht etwa weil sie etwas gegen deren verzweifelte Forderungspolitik hätten, sondern weil „ein moralisches Bekenntnis“ (ib.) abverlangt wird. Das beständige Wetzen dieses Stachels ihres Willens paßt ihnen nicht. Die Form der Durchsetzung Marburger Politik ist ihnen ein Greuel: Bei politischen Veranstaltungen greifen sie nicht etwa in die Auseinandersetzungen ein, sondern sitzen schmarotzend dabei und werfen der Avantgarde der Marburger Linken, dem MSB, vor: „Die Übermacht des MSB erdrückt den einzelnen Studenten.“ Politische Stellung zu beziehen empfinden sie „als eine große Einschränkung. Wir müßten auf bereits vorbereitete Frage antworten. Wo bleibt da die Diskussion.“ (WUP) Weil sie jede Konsequenz politischer Arbeit stört, denunzieren sie Politik überhaupt als bösartig. Ihr Geschäft ist darum die Zerstörung jeder Politik, sei sie nun richtig oder falsch.
Ihr politisches Vorgehen ist antipolitisch: politische Strukturen wollen sie „aufbrechen,... jedoch nicht, um unsere eigene Politik durchzusetzen, wie das beim MSB der Fall ist.“ (WUP) Mit ihrer Forderung nach Diskussion wollen sie erklärtermaßen Politik „in Frage stellen“ und damit verhindern.
Den Erfolg dieses Angriffs auf Politik bezeugt schließlich die für Marburg so charakteristische Vielfalt ausgeflippter Gruppen, die als „Grüner Gummihammer“, „Stiefmütterchen“, etc. abseits der politischen Szene dahinvegetieren.
Kommunistische Politik in Marburg und ihre Feinde
So also stellt sich die bizarre politische Landschaft Marburgs dar: Angesichts der Befriedungspolitik des Staates liefern sich die Linken diesem Gegner aus, um sich in diesem Geschäft als Linke Anerkennung zu holen. Die Quittung für den politischen Aberwitz erhalten sie in der Redaktion der Studenten, die über solche Politik zu Feinden linker Politik werden. Kommunistische Politik in Marburg ist der Kampf gegen die Marburger Kommunisten.
____________________________________
Anschauungsmaterial für das Prinzip der Marburger Linkspolitik findet sich auch in MSZ Nr. 2 1974 („Ein langer Atem geht durch Marburg. Sozialkampf und kein Ende“), sowie in MSZ Nr. 8 1975 („Der Kommissar in Marburg“)
aus: MSZ 12 – Juli 1976